Infrastrukturbruch
Dr. Bernhard Graeber (Talanx), André Pfleger (Sparkassen-Versicherung), Maik Schulze (Gothaer), Dr. Volker Breisig (PWC) und Reinhard Liebing (Alceda) im Gespräch mit Patrick Eisele zu Trends, Strukturbrüchen und Risiken in der Asset-Klasse Infrastruktur.
Sehr geehrte Herren Dr. Graeber, Pfleger und Schulze, wo stehen Talanx, Sparkassen-Versicherung und Gothaer bei Infrastruktur?
Dr. Bernhard Graeber: Die Talanx hat 2011 mit direkten und indirekten Infrastrukturinvestitionen begonnen. Inklusive der Commitments haben wir inzwischen knapp eine Milliarde Euro in Infrastruktur investiert. Bis 2017 sind knapp zwei Milliarden Euro Investitionen in diesem Segment geplant, wobei darüber hinaus auch ein weiterer Ausbau vorstellbar ist. Im Front-Office, im Rechtswesen und im Risikocontrolling beschäftigen sich etwa zehn Leute mit Infrastrukturinvestitionen. Zusätzlich bedienen wir uns noch bedarfsweise externer Berater.
Können Sie sich auf die Sachversicherungen oder die Private-Equity-Abteilung stützen?
Graeber: Hier gibt es durchaus Synergien. Die Private-Equity-Abteilung hilft teilweise bei der Administration. Bei bestimmten Projekten und technischen Fragen sprechen wir auch unsere Experten aus der Industrieversicherung an. Über unser langjähriges Geschäft als Industrieversicherer haben wir zum Beispiel weitreichende Expertise bei der Beurteilung von Windkraftanlagen aufgebaut. Davon profitieren wir auch bei entsprechenden Finanzierungsprojekten. Zudem nutzen wir Querschnittsfunktionen wie die Konzernrechts- oder -steuerabteilung.
André Pfleger: Die Sparkassen-Versicherung beschäftigt sich seit 2009/2010 mit Infrastruktur. Gestartet sind wir mit Direktinvestitionen in Erneuerbare Energien. Seit 2011 sind wir Teil des Amprion-Konsortiums. Damit war unser Portfolio sehr auf Deutschland fokussiert. Für den weiteren Ausbau haben wir uns entschieden, zusammen mit einem Partner, der sich vor allem um die Managerselektion kümmert, indirekt über Singlefonds in verschiedene Infrastruktursegmente zu investieren. Der Weg über Fonds lag auch wegen unserer beschränkten Ressourcen nahe. Zudem kennen wir den Due-Diligence-Prozess von Singlefonds seit etwa einem Jahrzehnt von Private Equity.
Mitsamt der Commitments haben wir mittlerweile deutlich über 300 Millionen Euro über mehrere Gesellschaften investiert. Auch mit Blick auf die Diversifikation an Strategien und Partnern sind wir auf einem guten Weg. Am Ende des Weges sind wir aber noch nicht angelangt. Renewables stellen für die SV nur einen begrenzten Teil der Infrastrukturallokation dar. Bedeutender für uns sind die Themen Versorgungsnetze und in zunehmendem Maße auch PPP-Modelle.
Wie liefen die Directs in Renewables?
Pfleger: Als mittelgroßer Versicherer machten wir die Erfahrung, dass solche Direktinvestments viele personelle Ressourcen binden. Man muss sehr nah am Asset dran sein und Spezialisten einsetzen.
Mit dem Investment selbst sind wir gerade im Niedrigzinsumfeld sehr zufrieden. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass es die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt war.
Auch die Gothaer hat direkt in Renewables investiert und dabei ihre Expertise als Sachversicherer spielen lassen.
Maik Schulze: Ja. Wir haben uns wie die Talanx seit 2011 mit Erneuerbaren Energien beschäftigt. Diesem Infrastruktursegment gilt nach wie vor unsere Konzentration. Mit einem Vier-Personen-Team und internen und externen Beratern, unter anderem für die technische Seite, haben wir bis dato mit Commitments etwa 700 Millionen Euro investiert und wollen diese Asset-Klasse weiter ausbauen. Wir sehen noch Opportunitäten.
Bei einem französischen Windpark, den die Gothaer versichert, wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie auch Energie gespeichert. Ist das „die Zukunft“?
Schulze: Für viele Experten haben Energiespeicher eine große Zukunft. Aus Investmentsicht sind wir hier zurückhaltender. Wir sind Energiespeichern aber nicht abgeneigt, wenn diese bei einem Projekt dabei sind.
Dr. Volker Breisig: Energiespeicher sind ein sehr wichtiges Thema. Schließlich kann die Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien nicht gewährleistet werden. Da die Kraftwerkskapazitäten bis 2023 zurückgehen, entsteht eine Lücke bei der gesicherten Leistung, die geschlossen werden muss. Ab wann das gegebenenfalls auch durch Speicherlösungen erfolgen kann, ist offen. Sicher benötigt man in den kommenden Jahren weiter konventionelle Kraftwerke. Wir sehen ab 2017 die ersten halbwegs effizienten Speicherlösungen als Ergänzung für beispielsweise Photovoltaik. Hier kann vor allem durch Marktteilnehmer wie Tesla ein Preisverfall eintreten. Noch ist eine wirtschaftlich vertretbare großtechnische Anwendung mit mehrtägiger Speicherung schwierig.
Graeber: Im aktuellen Marktumfeld gibt es für Speicher noch keinen Business Case. Es gibt auch noch keinen regulatorischen Rahmen für Stromspeicher, der für halbwegs kalkulierbare und auskömmliche Renditen sorgt. Pumpspeicherkraftwerke sind nach wie vor wirtschaftlich am attraktivsten. Aber selbst diese amortisieren sich nicht.
Pfleger: Wann gibt es eine kritische Masse beim Thema Stromspeicher, um den ökonomischen Break-even zu erreichen?
Breisig: Die Diskussion über Kapazitätsmärkte wurde intensiv geführt und erfolglos beendet. Nun wird der Strommarkt 2.0 eingeführt, der Preisspitzen zulässt. Wir vermuten, dass dieses Modell nicht zu ausreichenden Investitionen in gesicherte Leistung führen wird und man in drei Jahren die Diskussion um die Versorgungssicherheit neu aufnehmen muss. Das jetzige System kommt bestimmt noch einmal auf den Prüfstand.
Erfolgreicher war die Diskussion um eine Kürzung der Eigenmittelunterlegungen für Infrastruktur nach Solvency II. War das für Sie eine vorweihnachtliche Bescherung?
Pfleger: Positiv ist, dass ein regulatorisches Investitionshemmnis weggefallen ist. Damit ist eine Hürde abgebaut. Diese Entscheidung bestätigt auch den politischen Willen, diese Asset-Klasse für private Gelder offenzuhalten. Geblieben sind aber die Probleme, gute Assets mit den richtigen Partnern zu finden. Darum erwarte ich nun keinen ungebremsten Infrastruktur-Boom.
Schulze: Auch für uns ist die Kürzung der Eigenmittelanforderungen ein starkes Signal. Die Auswirkungen auf die Praxis muss man aber erst einmal abwarten.
Wer wie die Talanx ein internes Solvency-II-Modell nutzt, profitiert weniger, freut sich aber zumindest über die Signalwirkung?
Graeber: Stimmt. Die Entscheidung kam auch bei uns positiv an, wir sind wegen unseres internen Modells aber weniger betroffen. Wir erwarten, dass mit unserem internen Modell eine geringere Eigenkapitalhinterlegung erforderlich ist als beim Standardmodell. Dabei ist es natürlich unser Anspruch, dass wir das Portfolio risikoadäquat abbilden und abhängig von den Assets differenzieren. Für manche Assets ist eine Unterlegungsquote von 30 Prozent zu viel, für manche zu wenig. Schlussendlich hängt der Eigenkapitalbedarf von den Assets und den Korrelationen im Gesamtportfolio ab.
Geht es künftig vor allem darum, attraktive Assets finden und abbilden zu können?
Pfleger: Das entspricht unserer Sicht. Die Basisanalyse ist, ob das Asset Sinn macht und in das Portfolio passt. Im Vergleich zu vor fünf Jahren kam es in den klassischen Infrastrukturthemen, wie in den anderen Asset-Klassen, zu einer Renditeerosion. Auf der organisatorischen Seite kommt bei uns hinzu, dass unsere Ressourcen überschaubar sind. Darum ist für uns bei der Managerselektion ein wichtiges Thema, ob der Manager die für seine Investmentideen notwendigen Assets auch zu einem vernünftigen Preis und Zeitrahmen erwerben kann. Bisher sind wir mit diesem Modell sehr gut gefahren.
Der Vorteil eines großen eigenen Teams liegt dagegen sicherlich in dem erweiterten Spektrum an Möglichkeiten. Man kann dann aufgrund von unterstellten Kosteneinsparungen auch Direktinvestments mit eventuell niedrigeren Renditeanforderungen als Fondsinvestor tätigen.
Schulze: Asset-Sourcing wird auch aus unserer Sicht das zentrale Thema bleiben – insbesondere wenn man eine gewisse Portfoliodiversifikation nach Segmenten und Regimen erreichen möchte. Wichtig ist zudem, die Zielquoten auch zu erreichen. Um zum Beispiel einen Solarpark in einer bestimmten Region zu bekommen, braucht es ein entsprechendes Netzwerk. Und solche Netzwerke müssen gepflegt werden, was wiederum interne Ressourcen erfordert.
Reinhard Liebing: Bislang sind deutsche Versicherer im Schnitt nur zu etwa einem Prozent in Infrastruktur investiert. Die Zielquoten liegen wohl häufig nur etwas höher. Einzelne deutsche Versorgungswerke haben Zielquoten für Infrastrukturinvestments von 15 Prozent. Gerade diese Versorgungswerke haben sich mit einem Rechnungszins von vier Prozent zudem auch noch ein ehrgeiziges Renditeziel gesetzt. Dafür muss man ins Risiko gehen, und Infrastruktur weist sicherlich attraktive Risikoprämien auf. Laut einer Studie der OECD von 2014 haben in den vergangenen Jahren große Pensionsfonds, insbesondere aus Australien und Kanada, ihre Allokationen von zehn auf bis zu 15 Prozent erhöht. Damit sind die erwähnten Versorgungswerke in guter Gesellschaft.
Allerdings sollte man auch Infrastrukturanlagen beziehungsweise -projekte in Betracht ziehen, die abseits des Mainstreams liegen und übergeordnete Trends mit hoher Systemrelevanz abbilden. Erneuerbare Energien sind im Gesamtkontext der Energiewende zu sehen, die neben der Erzeugung insbesondere auch auf die Energieeffizienz setzt. Dies ist vor dem Hintergrund der Klimaziele der Bundesregierung zu sehen und Ausdruck des globalen Klimawandels, der sich nun auch in den Asset-Allokationen der Investoren niederschlägt. So hat beispielsweise der norwegische Öl- und Pensionsfonds kürzlich beschlossen, sich aus Kohleinvestments zurückzuziehen. Der Klimawandel ist insoweit nicht nur ein Risiko für die Asset-Allokation, sondern auch eine Chance, um in „clean Technologies“ zu investieren. Hierzu gehören im Wesentlichen neben Wind- auch Wasserkraft- und Solarinvestments. Daneben gilt es, Megatrends wie die Digitalisierung zu berücksichtigen, denn ohne eine leistungsfähige digitale Infrastruktur funktioniert kein Smart Home, Smart Grid und Smart Metering.
Sollte man sich, um den Aufwand fürs Netzwerken zu reduzieren, auf bestimmte Assets konzentrieren, dann aber auch Entwicklungs- oder Emerging-Markets-Risiken nehmen?
Schulze: Das sind relevante Überlegungen. Jeder wird hier seine individuelle Antwort haben. Wir für uns haben entschieden, keine Projektentwicklungsrisiken zu nehmen. Dafür haben wir eine kleine Allokation in den Emerging Markets.
Es gibt Schwellenländer, die in Dollar abrechnen. Exotische Währungen möchten wir nicht. Das wirkt ebenfalls limitierend.
Liebing: Zu Netzwerken: Wir sehen in der Praxis verstärkt die Bildung von gewissen „Symbiosen“ insbesondere zwischen Finanzinvestoren, Energieversorgern und Projektentwicklern. Hierbei nehmen wir eine wertvolle Schnittstellenfunktion wahr, um partnerschaftliche Lösungen zu entwickeln.
Graeber: Zwischen strategischen Investoren und Finanzinvestoren bestehen aber auch Unterschiede. In der Regel hat ein strategischer Investor andere Interessen und Anforderungen. Von daher kann es leichter sein, wenn man ein Konsortium mit Finanzinvestoren bildet.
Schulze: Den Begriff „Symbiose“ würde ich auch nicht verwenden. Beide Investorentypen sind keine geborenen Partner, sondern haben natürliche Interessengegensätze, vor denen man die Augen nicht verschließen darf. Bei einem Projekt gibt es aber verschiedene Teilbereiche, wie energiewirtschaftliche Regularien und Technik, die von einem Energieversorger besser abgedeckt werden.
Liebing: Absolut. Es ist ganz wichtig, dass man sich mögliche Konflikte transparent macht und dafür entsprechende (Ausgleichs-)Regelungen schafft. Aus diesen potenziellen Konflikten rührt ja auch der Wunsch der Investoren nach einer möglichst hohen Transparenz und einem Gleichklang der wirtschaftlichen Interessen.
Zu den Lösungsbausteinen zählt, dass man beispielsweise bestimmte Mindestausschüttungen vereinbart. Insoweit macht auch die Zwischenschaltung einer regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Sinn, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung wie ein „Treuhänder“ ausschließlich im Interesse der Anleger handelt.
Graeber: Das erhöht aber den Aufwand. Grundsätzlich muss sich ein Finanzinvestor überlegen, wie komplementär die Interessen sind und welche Reibungsverluste er bereit ist, in Kauf zu nehmen. Das fängt zum Beispiel bei der Bilanzierung an – es kann sein, dass ein Partner nur nach HGB und die anderen nach IFRS bilanzieren möchten.
Dass ein strategischer Investor eine Beteiligung enger steuert und eine tiefere Marktkenntnis hat, kann für einen Finanzinvestor auch zum Nachteil werden – gerade dann, wenn der strategische Investor ganz andere Interessen verfolgt. Zum Beispiel sind bei bestehenden Windparks die Handlungsspielräume begrenzt. Wenn ein Asset aber eher unternehmerischen Charakter hat, besteht eine größere Gefahr, dass die Interessen divergieren.
Pfleger: Partnerschaften können interessant sein. Wenn man für die Zusammenarbeit ein replizierbares Set-up hat und nicht immer neu suchen und verhandeln muss, spart dies viel Zeit. Aber einen Partner zu finden, bei dem man davon ausgeht, dass man sich mit ihm auch in 15 Jahren noch wohlfühlt, ist schwer.
Graeber: Nüchtern betrachtet: Die Welt und die Interessen ändern sich nun mal im Laufe der Zeit. Es kann sein, dass ich heute eine möglichst sichere Ausschüttung bevorzuge, in zehn Jahren aber lieber thesaurieren möchte.
Wenn man sich die Energiewirtschaft ansieht, haben die großen Marktteilnehmer in den vergangenen zehn oder 20 Jahren die Strategie mehrfach geändert. In zehn Jahren werden beide Partner wahrscheinlich auch nicht mehr von den gleichen Vorständen geführt.
Dass Netzwerke so wichtig sind, verwundert mit Blick auf den großen Investitionsbedarf.
Graeber: Generell gibt es genügend Assets. Man muss aber nüchtern konstatieren: Die Versicherungswirtschaft wird als Investor nicht unbedingt gebraucht. Wir sind nicht erforderlich, um Finanzierungslücken zu schließen. Es gibt genug Kapital zum Beispiel von Fonds oder ausländischen, strategischen Investoren zur Finanzierung der Energiewende. Das mag die Politik anders sehen, das ist aber die Realität. Weiter ist zu beachten, dass die Märkte in der Regel relativ intransparent sind. Für viele, insbesondere kleinere Assets werden nur wenige, teilweise auch nur ein ernsthafter Interessent angesprochen. Von der großen Infrastrukturwelt sieht man, wenn überhaupt ein Zugang besteht, oft nur einen kleinen Ausschnitt der Transaktionen. Drittens sind höhere Renditen mit höheren Risiken, Illiquidität, Komplexität oder Intransparenz zu bezahlen. In vielen Fällen bleibt von diesen Prämien, die über einen angemessenen Ausgleich für die Risiken hinausgehen, wenn überhaupt nur noch wenig übrig. Dazu besteht noch ein nicht unerheblicher Aufwand für Direktinvestitionen.
Breisig: Zu beachten ist zum einen, dass die Verschuldungsquote bei den Energieversorgern steigt. Dies ist inzwischen auch bei den Stadtwerken der Fall. Zum anderen, dass die Energiewende, was die Erzeugung betrifft, von Privatleuten und Investoren getragen wurde und deren Engagement bei sinkenden Förderungen und zunehmender Komplexität schwinden wird. Erneuerbare gewinnen zudem nur weiter an Bedeutung, wenn auch die intelligente Netz- beziehungsweise Verbrauchs- und Erzeugungssteuerung ausgebaut wird. In diesem Umfeld wächst der Handlungs- und damit der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der Energiewendeziele.
Liebing: Institutionellen Investoren eröffnen sich insoweit Chancen, die sie auch wahrnehmen sollten. So versucht der Gesetzgeber gerade auch die Rahmenbedingungen für die Investition in Infrastruktur zu verbessern. Regulatorisch ist hier insbesondere an die Anlageverordnung und an Solvency II zu denken.
Graeber: Nochmal: Das ist am Markt nicht erkennbar. Es wird nicht händeringend nach Investoren gesucht. Der Wettbewerb unter Kapitalanlegern ist groß. Bei vielen Assets staunen wir über die Kaufpreise, die bezahlt werden und fragen uns, ob Risiken ausgeblendet wurden. Gelegentlich findet man aber auch sehr attraktive Assets.
Sehr oft wird bei Infrastruktur-Debt über im Rahmen von ÖPPs privat finanzierte Autobahnen oder Gebäude gesprochen. Drei Prozent Rendite lassen sich damit aber in der Regel zurzeit nicht verdienen.
Schulze: Dass die Risikoprämien sehr knapp sind, gilt gerade für Deutschland.
Graeber: Unter Berücksichtigung aller Faktoren rechnen sich viele Assets nur noch gefühlt. Ganz exakt lassen sich alle Risiken natürlich auch hier nicht quantifizieren. Bei Windparks hat ein Investor über die Windgutachten eine quantitative Einschätzung zur Risikoverteilung des Hauptrisikos Windertrag. Bei vielen anderen Assets ist es deutlich schwieriger, die Hauptrisikotreiber zu identifizieren oder gar belastbare Schätzungen zu erhalten, wie die Risikotreiber statistisch zu verteilen sind. In der Regel ist es daher auch nicht möglich, objektiv zu ermitteln, was eine adäquate Risikoprämie ist.
Schulze: Wenn Sie Wind ansprechen: Es ist erstaunlich, wie viel sensibler wegen des variableren französischen Tarifsystems die Ergebnisse bei der Modellierung eines Windparks in Frankreich ausfallen. Dazu sorgt die Intransparenz für nur schlecht abschätzbare Preisfindungsprozesse. Bevor man dort dazu kommt, ein Investment abzuschließen, produzierte man schon einige Kosten.
Graeber: Nach unserer Erfahrung werden die Risiken in Frankreich auch nicht besser bezahlt als in Deutschland. Oder Finnland, das derzeit ein bisschen gehypt wird: Im Kleingedruckten finden sich erhebliche, risikoerhöhende Abweichungen zum deutschen EEG, die nach meiner Einschätzung nicht eingepreist werden.
Ist Großbritannien das gelobte Land für Infrastruktur?
Graeber: In Großbritannien investieren wir derzeit wegen der Währung nicht. Ansonsten ist Großbritannien sehr attraktiv. Der regulatorische Rahmen ist relativ stabil und Renewables geben noch gute Renditen.
Pfleger: Wir haben in Großbritannien mittelbar über Fonds Windparks erworben. Interessant ist, dass es auf einer Insel, anders als oftmals in Deutschland, sehr windstarke Standorte gibt. Von schottischen Windgeschwindigkeiten kann man an deutschen Küsten gelegentlich nur träumen. Zudem stimmt das regulatorische Umfeld. Das Währungsrisiko ist aber einzupreisen. Wir sichern es zum Großteil ab.
Die Talanx gibt als Konsortialführer 556 Millionen Euro Fremdkapital über zehn Jahre für einen Offshore-Windpark. Dafür wurde Ihnen von den Eigenkapitalgebern Dong und Global Infrastructure Partners doch auch ein bisschen ein roter Teppich ausgerollt?
Graeber: Das ist übertrieben. Die Finanzierung wurde zu marktgerechten Konditionen abgeschlossen. Es ist aber richtig, dass es bei den Beteiligten ein strategisches Interesse gab, institutionelle Investoren aus Deutschland einzubinden. Das hat uns möglicherweise ein paar Basispunkte zusätzlich gebracht. Es ist aber nicht so, dass niemand anderes als Finanzier eingesprungen wäre. Wir wurden nicht als einzige angesprochen.
Liebing: Etwas Besonderes ist die Transaktion aber schon, da zum ersten Mal unter Führung einer Versicherung ein Konsortium gebildet wurde. Banken fällt es aufgrund von Basel III nicht leicht, langfristige Finanzierungen zu vergeben. Damit ist die Transaktion ein Beispiel für die massiven Marktveränderungen. Versicherer wandeln sich insoweit quasi zu Banken.
Wir haben im vergangenen Jahr anlässlich eines Projekts in Schweden eine Lead-Investoren-Struktur mit einem Energieversorger entwickelt. Diese Struktur haben wir sowohl auf der Equity- als auch auf der Debt-Seite mit institutionellen Investoren diskutiert. Es zeigte sich sehr schnell, dass für einige Investoren nur die Debt-Seite in Betracht kam, dann aber auch komplett.
Graeber: Die Transaktion war insofern ein Novum, da Talanx den Lead gemacht hat und damit ein Zeichen gesetzt hat, dass auch neue Konstellationen möglich sind. Die Transaktion war aber nicht dem Umstand geschuldet, dass man sie nicht auch über ein Bankenkonsortium hätte finanzieren können. Banken hätten die Finanzierung stemmen können. Dann hätte der Sponsor eben mit einem knappen Dutzend an Banken und nicht nur mit dem Lead-Arranger eines Versicherungskonsortiums sprechen müssen.
Liebing: Ist die Transaktion nicht auch für Versicherungsunternehmen ein Wink, sich stärker in der ersten Reihe zu positionieren, wenn solche attraktiven Assets auf den Markt kommen? Der kritische Asset-Zugang fällt leichter, wenn man frühzeitig in Projektentwicklungen und Bauprojekte eingebunden wird. Wir sehen eine zunehmende Zusammenarbeit von Energieversorgern mit Projektentwicklern und vereinzelt auch mit Investoren, wobei die Partner für bestimmte Phasen zielgerichtet zusammenarbeiten, um die Projektentwicklungen zu attraktiven Konditionen umzusetzen.
Eine Frage, die sich mir hier auch stellt: Unter welchen Rahmenbedingungen sind Versicherungen bereit, in Eigenkapitalrisiken zu gehen?
Pfleger: Für Eigenkapital spricht natürlich der höhere Renditebeitrag zur Gesamtverzinsung des Portfolios und das Vorhandensein bekannter Strukturen analog zu Private Equity. Zudem ist sehr differenziert zu betrachten, ob Banken sich tatsächlich aus Projektfinanzierungen zurückziehen.
Aktuell spricht gegen die Entscheidung, ein eigenes Team für Sourcing, Kreditüberwachung et cetera aufzubauen, dass der Rendite-Pick-up nicht attraktiv genug ist. Bei längeren Laufzeiten könnte es aber anders aussehen, und natürlich spielt auch eine Rolle, ob man ein mittelgroßer deutscher Versicherer ist oder ein Global Player wie die Allianz.
Breisig: Damit klingen Finanzierungen aus Versicherersicht nicht besonders attraktiv. Bestehen außerhalb der Energiewende attraktivere Alternativen für institutionelle Anleger? Für die Verkehrsinfrastruktur sind beispielsweise auch große Investitionen nötig.
Pfleger: Die Einstiegsrenditen beim Thema Energieerzeugung stoßen aus meiner Sicht an eine Grenze, wo man sich fragen muss, ob weitere Investitionen sinnvoll sind. Verkehrsinfrastruktur kann da eine mögliche Alternative sein. Hierfür werden aber für Direktinvestments entsprechende Spezialisten benötigt. Andere Themen wie beispielsweise soziale Infrastruktur sind aber oft zu kleinteilig, auch um dafür erfahrene Spezialisten zu beschäftigen. Diese Aspekte sind auch wichtig für die Entscheidung über das Insourcing oder Outsourcing: Wo liegt die kritische Masse bei den Assets under Management, um eine bestimmte Zahl an internen Mitarbeiter sinnvoll zu beschäftigen?
Im Bereich von Infrastruktur oder Alternatives im Allgemeinen liegt diese Grenze aus meiner Sicht niedriger als in den traditionellen Asset-Klassen Renten und Aktien. Oftmals ist daher die Unterstützung durch einen externen erfahrenen Partner eine gute Idee.
Wo liegt denn die Renditeerwartung für den Offshore-Windpark? Was ist der Pick-up?
Graeber: Bei Fremdkapital liegt die Renditeerwartung zwischen drei und vier Prozent. Man sollte aber nicht nur auf die Rendite schauen. Wenn man die Struktur und die Bedingungen nicht kennt, vergleicht man leicht Äpfel mit Birnen. Entscheidend ist die risikoadäquate Rendite.
Wir haben uns bei dieser Finanzierung engagiert, weil das Rendite-Risiko-Verhältnis gut ist. Es bestehen Besicherungen und auch ein externes Investmentgrade-Rating.
Pfleger: Wie komplex war denn der Aufwand für Erwerb und Strukturierungen der Offshore-Windpark-Finanzierung?
Graeber: Öfter als einmal im Jahr können wir wegen der Komplexität und unserer begrenzten Ressourcen eine solche Transaktion bisher nicht umsetzen. Darum sind wir bei vielen komplexeren Projekten auf Partner angewiesen. Auch sehr komplexe Eigenkapitaltransaktionen können wir nicht als Lead, sondern allenfalls als Co-Investor machen.
Klassischerweise sind Asset Manager die Partner für indirekte Investments. Wie viel Inhouse-Expertise braucht es für Fondsinvestments im Vergleich zu Directs?
Graeber: Ich schätze, dass der Aufwand bei einem Co-Invest auf 20 bis 30 Prozent zu dem eines Directs sinkt. In manchen Fällen kann es auch weniger sein. Bei einem Fondsinvestment ist der Aufwand nochmal deutlich geringer.
Muss ein Infrastrukturfonds auch Co-Investments anbieten?
Pfleger: Er sollte, schließlich ist Asset Sourcing ein Problem. Noch haben wir keine Co-Investments gemacht. Auch hier sind die Ressourcen der Engpass. Für Co-Investments braucht es auch eine gewisse Geschwindigkeit. Zudem wird der Fondsgedanke einer Diversifizierung durch Co-Investments konterkariert.
Graeber: Wenn ein Fonds Co-Investments anbietet, ist das gut. Aber nur wegen dieser Möglichkeit werden wir keinen Fonds zeichnen. Wir haben ein Co-Investment abgeschlossen. Bei einigen Auktionen waren wir erfolglos mit dabei, bei einem weiteren, aktuellen Co-Investment-Angebot war für uns und unsere Gremien die Zeit zu knapp und die Komplexität zu hoch.
Wenn ein solches Angebot zum Beispiel in die Ferienzeit fällt oder wir viele andere Transaktionen am Laufen haben, müssen wir erkennen, dass wir für die notwendige Prüfung bislang noch nicht perfekt aufgestellt sind.
Abschreckend wirkt auch, dass man bei Auktionen oft bis zum Schluss involviert ist und dann doch nicht zum Zug kommt. Möglicherweise ist sich der Verkäufer mit einem präferierten Käufer auch schon weitgehend handelseinig geworden und macht nur noch pro forma einen Bieterprozess.
Pfleger: Der Kampf um gute Assets ist aktuell sehr hart. Vielleicht spielt das Thema Verlässlichkeit bei Bieterprozessen einmal eine größere Rolle. Gerade wenn der Verkäufer strategische Überlegungen hat, ist für ihn wichtig, dass der Deal auch wirklich vollzogen wird. Verlässlichkeit würde für Versicherungen sprechen.
Graeber: Ich kenne aber auch Verkäufer, die an institutionelle Investoren nicht verkaufen wollen. Ihnen sind Institutionelle zu kompliziert und mühsam, weil sie nicht pragmatisch genug sind und für alles eine rechtliche Absicherung haben wollen. Um erfolgreich zu sein, muss man sich von diesem Stereotyp abheben.
Könnten Power-Purchase-Agreements eine Alternative zu Auktionen sein? Ein Beispiel ist, dass die Allianz in Skandinavien mit einem Windpark ein Rechenzentrum von Google mit Strom versorgt.
Liebing: Längerfristige Power-Purchase-Agreements sind sicherlich ein Weg, um abseits staatlicher Förderungen, nachhaltige stabile Cashflows zu generieren. Google strebt eine 100-prozentige Versorgung des Unternehmens mit Erneuerbaren Energien an. Dies unterstreicht sehr schön den übergeordneten Trend, dem Erneuerbare Energien unterliegen. Der Trend in Richtung „Green Internet“.
Graeber: Aber institutionelle Investoren sind nicht die prädestinierten Player, um solche Stromabnahmeverträge einzufädeln. Andere haben hier deutlich bessere Netzwerke.
Liebing: Genau diese Schnittstellenfunktion zwischen den unterschiedlichen Welten von Energieversorgern, Projektentwicklern und Investoren können wir übernehmen.
Mich fragte beispielsweise einmal ein Energieversorger, ob eigentlich alle Versicherer einen Genussschein haben wollen. Hier gilt es, ein gemeinsames Verständnis füreinander zu schaffen, um die Vorteile einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu nutzen.
Breisig: Sind Renewables für Finanzinvestoren eigentlich noch interessant, wenn das EEG ausläuft? Die sicheren Einspeisevergütungen verschwinden und eine große Komplexität bleibt zurück. Damit besteht ein hoher Aufwand und es braucht einen Partner, auf den man sich verlassen muss.
Schulze: Wenn wir keine Strukturen finden, in denen wir sicher investieren können, und wenn die Assets weiter so hart umkämpft sind, dann sind die Kosten zu hoch und wir sind nicht mehr dabei.
Graeber: Wenn die Cashflows klar kalkulierbar sind, ist das natürlich sehr hilfreich. Deswegen fühlt man sich mit dem alten EEG auch sehr wohl. Für uns ist immer wichtig, dass wir die Assets kennen und beurteilen können. Es muss aber nicht alles reguliert sein. Wir können auch mehr Risiken eingehen. Wir wollen aber wissen, auf welche Risiken wir uns einlassen und diese einschätzen können.
Pfleger: Das alte EEG war eine schöne Opportunität. Man hätte aus heutiger Sicht vor zehn Jahren vermutlich mehr investieren sollen, aber das Thema war für einen Versicherer damals auch etwas völlig Neues.
Der deutsche Markt für Renewables ist heute praktisch leergefegt, und warum sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, wenn man nicht weiß, wie die Welt in drei Jahren aussieht. Das ist kein Investment-Case für eine Versicherung. Wenn es mit der Energiewende weitergehen soll, muss die Politik einen langfristig verlässlichen Investitionsrahmen liefern.
Von der Vergangenheit in die Zukunft: Kann es sein, dass bei Renewables in zehn Jahren gar nicht mehr Ausschüttungen im Vordergrund stehen, sondern der Erhalt des Net Asset Value und Repowering-Strategien?
Schulze: Sehr schwere Frage. Ausschüttungsanforderungen können sich natürlich ändern. Grundsätzlich sollten sich die Anlagen in zwanzig Jahren gerechnet haben. Dann wird man sehen, ob man diese verkaufen oder weiterbetreiben kann.
Repowering könnte an Bedeutung gewinnen, da die guten Standorte endlich sind, dort aber die Anlagen veralten. In welche Richtung es geht, ist offen. Sorgen machen wir uns auf jeden Fall keine.
Pfleger: Für uns ist es extrem wichtig, wie gut sich die Partner um unsere Assets kümmern und dass die Assets auch langfristig ihren Wert behalten. Diese Leitlinie sollte beim Investieren in Infrastruktur oder andere Real Assets immanent sein. Die Qualität des Managements der Assets entscheidet aus meiner Sicht letztlich über Extra-Returns.
Liebing: Abseits der Erzeugung haben beispielsweise klassische Umspannwerke eine hohe Systemrelevanz. Ein Umspannwerk muss auch in 20 Jahren noch funktionieren und auf dem neuesten Stand der Technik sein.
Graeber: Es macht keinen Sinn, sich nur auf Erneuerbare Energien zu konzentrieren. Es stellt sich aber immer die Frage nach der Komplexität, Transparenz und Regulierung. Was es bei Renewables natürlich einfacher macht, ist, dass wir die Anlagen auch versichern. Im Konzern ist also schon bekannt, wie ein Windpark funktioniert. Für klassische PPP-Projekte, die über 30 Jahre betriebsbereit gehalten werden müssen, sprechen die sichere Verfügbarkeitszahlung und damit die gute Kalkulierbarkeit. Bei anderen Assets ist unser Zugang weniger gut.
Liebing: PPP-Modellen mangelt es aus meiner Sicht in der Regel an skalierbaren Strukturen. Es bestehen mehrjährige Entscheidungsprozesse und die Renditen sind oft mager.
Was gibt es alternativ zu Energie?
Pfleger: Es ist sinnvoll, nicht nur die deutsche Energiewende als einziges Infrastrukturthema für öffentliche Versicherer zu sehen, sondern auch zum Beispiel soziale Infrastruktur oder Transport. Wie bereits erwähnt sehen wir das Thema Versorgungsnetze als das eigentlich ideale Asset aus dem Bereich Infrastruktur, insbesondere unter ALM-Aspekten.
Liebing: Viele Investoren haben sich bei Flugzeug- oder Schiffsfinanzierungen engagiert. Das sind zwar keine klassischen Infrastrukturinvestitionen. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise sollte der Blick allerdings auch auf Assets gerichtet werden, die eine gewisse Systemrelevanz haben und aufgrund vertraglicher Strukturen nachhaltige stabile Cashflows liefern. Spezialschiffe für die Versorgung von Offshore-Windenergieanlagen könnten hierfür eventuell ein Beispiel sein.
Graeber: Wir sehen Flugzeuge, Schiffe oder Schienenfahrzeuge derzeit nicht als Infrastruktur im engeren Sinne. Infrastruktur sollte einen gewissen Monopolcharakter haben und eine gewisse Grundversorgung darstellen. Diese Zuordnung ist aber nicht in Stein gemeißelt.
Segmente, in denen wir ebenfalls aktiv sind beziehungsweise die wir für attraktiv halten, sind Transport- und Verteilnetze für Strom, Gas und Wasser, Transportinfrastruktur im Falle von Straßen, Häfen und Bahninfrastruktur, Telekommunikation und soziale Infrastruktur. Bei Letzterem handelt es sich in der Regel um ÖPP-Projekte, wie zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser.
Was gibt es an weiteren Themen?
Liebing: Beispielsweise die Digitalisierung. Alle 18 bis 24 Monate verdoppelt sich der globale Datenbestand. In Deutschland haben wir bereits eine „Digitale Agenda“ und Berlin hat jüngst eine Smart-City-Strategie verabschiedet. Wir brauchen also eine leistungsfähige digitale Infrastruktur für Themen wie Industrie 4.0 und E-Mobility.
Hierfür gilt es, ganzheitliche Finanzierungs- und Beteiligungskonzepte zu entwickeln. Um frühzeitig solche Trends zu nutzen, sollte man sich diese Themen daher sehr genau ansehen.
Pfleger: Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind Versicherungen bei Investmentthemen eher selten die Ersten, die auf ein neues Thema aufspringen, was auch richtig ist. Für einen Investment Case, der für eine Versicherung vertretbar ist, braucht es Rahmenbedingungen, die für Ausschüttungen und vernünftige Renditen bei überschaubaren Risiken sorgen. Versicherungen ist es lieber, wenn jemand anderes die ersten – schlechten – Erfahrungen macht.
Aus meiner Sicht dürften der Klimawandel und die Digitalisierung der Datenströme für die meisten neuen Investitionsfelder sorgen. Neben dem Thema Energiespeicher sollte das Thema Energieeffizienz stärker in den Investitionsfokus rücken, wobei ich mit Ausnahme weniger Einzelfällen noch nicht viele für einen Versicherer investierbare Geschäftsmodelle gesehen habe. Auch der steigende Bedarf an Versorgung mit Trink- oder Süßwasser dürfte für viele Regionen der Welt immer wichtiger werden. Ob hier Versicherer allerdings investieren werden, dürfte stark vom politischen Risiko der Assets abhängen.
Breisig: Mit Energieversorgern verbindet man aber aktuell auch nicht mehr primär Finanzkraft. Es fehlt jemand, der bereit ist, die hohen Risiken der Anfangsphase zu nehmen.
Graeber: Hier sind wir nicht mehr bei Infrastruktur, sondern bei Private Equity. Bei Private Equity geht es unter anderem um First-Mover-Renditen, die aus unternehmerischen Aktivitäten erzielt werden sollen.
Schulze: Das Beispiel Offshore zeigt, dass ein Segment schon eine gewisse Wegstrecke im Lebenszyklus zurückgelegt haben muss, damit Versicherer bereit sind, neue Risiken zu nehmen.
Liebing: Dänische Pensionsfonds haben schon vor einigen Jahren begonnen, mit Eigenkapital in Offshore-Windparks zu investieren. Deutsche institutionelle Investoren sind noch immer zögerlich, wenn es um Offshore-Beteiligungen geht. Vielleicht ist hier ein engerer Austausch mit solchen Pensionsfonds beziehungsweise mit Energieversorgern sinnvoll, die sich an solchen Parks beteiligt haben.
Schulze: Zu bedenken ist, dass deutsche Versicherungen eben auch ein anderes Produktportfolio offerieren.
Von Patrick Eisele
portfolio institutionell, Ausgabe 12/2015
Autoren: Patrick Eisele In Verbindung stehende Artikel:


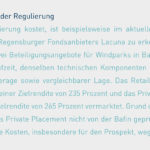

Schreiben Sie einen Kommentar