Wo und wie Investoren um die öffentliche Hand anhalten

Kinder spielen auf einer Wiese. Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein hat in seinem Geschäftsgebiet in Kindergärten investiert.
Das Versorgungswerk der Zahnärzte Nordrhein investiert auch in Nischen, gerade wenn es sich um soziale Infrastruktur handelt. Schätzen gelernt hat man auf diesem Weg aber auch die Ressourcen eines großen Asset Managers – zumal, wenn es ein Ansatz ist, der nicht nur die finanzielle Rendite im Fokus hat. Letzteres bewährt sich insbesondere bei Assets der sozialen Infrastruktur.
Dramatische Szenen in Nordrhein-Westfalen: Mehrere Explosionen erschüttern ein Gebäude, in dem Terroristen sich mit Geiseln verschanzt haben. Das Geschrei Schwerverletzter gellt in den Ohren. Durch dicken Rauch versucht sich ein schwerbewaffnetes Spezialeinsatzkommando der Polizei Zutritt zu verschaffen.
Rückendeckung für den Stoßtrupp kommt vom Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein, VZN. Tobias Gorgs, stellvertretender Abteilungsleiter der Immobilienabteilung des VZN, bewahrt den Überblick über die Lage: „Gemeinsam mit einem Partner in Nordrhein-Westfalen investieren wir in den Bau von speziellen Trainingszentren, in der Polizeibeamte beispielsweise für den Dienst an der Waffe oder für Antiterroreinsätze ausgebildet werden. Die Drittverwendungsfähigkeit dieser Gebäude mag beschränkt sein, dafür haben wir aber mit dem Land Nordrhein-Westfalen einen sehr verlässlichen und standorttreuen Mieter, mit dem wir einen sehr langfristigen Mietvertrag abschließen konnten.“
Dass das bereits 1957 gegründete Versorgungswerk eher unkonventionelle Assets nicht scheut, bewies es bereits in der Vergangenheit – insbesondere, wenn es sich um Infrastruktur handelt. Ähnlich wie Real Estate nutzt diese Asset-Klasse wegen der laufenden Ausschüttungen insbesondere älteren Altersvorsorgeeinrichtungen, die Cashflow-orientierter planen müssen. Mit Blick auf die Mitgliederentwicklung – beim VZN stehen nun etwa 10.000 Anwärtern 5.000 Rentner gegenüber – erklärt Gorgs: „Um die Bedienung unserer Verpflichtungen sicherzustellen, sind ausschüttungsorientierte Investments in unserem Investmentansatz mehr und mehr in den Fokus gerückt.“ Aufgeschlossen ist man insbesondere dem Subsegment soziale Infrastruktur.
Investments in Kindergärten machen Schule, …
Im eigenen Geschäftsgebiet hat die Einrichtung der Zahnärztekammer Nordrhein, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, bereits in Pflegeheime, Kindergärten und Schulen investiert. 2015 fiel der Startschuss für Pflegeheime, in 2018 investierte man als alleiniger Investor mit einem Partner in Kindertagesstätten und deren Entwicklung. „Mit dem Fonds begegnen wir aktiv dem Versorgungsnotstand im Kindertagesstätten-Bereich. Indem wir die öffentlichen und gemeinnützigen Träger mit neuen Kindertagestätten und deren nachhaltigem Betrieb unterstützen, kommen wir gleichzeitig unserer sozial- und bildungspolitischen Verantwortung in unserer Heimatregion nach“, ließ sich damals VZN-Geschäftsführer Uwe Zeidler anlässlich des Investments zitieren. 2023 war das VZN, das insgesamt etwa vier Milliarden Euro anlegt, in 18 Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen investiert, sorgte damit für einen sozialen Impact und kann bei einem Leverage von 50 Prozent von staatlich geförderten Trägern mit einer finanziellen Rendite von 4,75 Prozent per annum rechnen.

Das Geld in heimischen Kindergärten und Schulen – oder auch im sozialen Wohnungsbau – unterzubringen, fällt jedoch schwer. „Wir haben nun ein großes Kita-Portfolio aufgebaut und sind mit diesem auch sehr zufrieden. Wegen der Kleinteiligkeit war der Aufbau aber sehr mühsam“, blickt Tobias Gorgs zurück. Weniger erfolgreich verlief der Versuch, in den Bau und in die Modernisierung von Schulen zu investieren. „Wir würden sehr gerne noch sehr viel mehr Geld in den Schulbau in Deutschland investieren und haben unsere Bereitschaft am Markt auch kundgetan. Stand heute ist jedoch die Umsetzung für einen institutionellen Investor, der auch einen ökonomischen Blickwinkel hat, nicht darstellbar. Das Problem ist, dass es schlicht an der Bereitschaft von Gemeinden und Städten mangelt, privates Geld zu akzeptieren.“ Diese Vorbehalte betreffen auch Fremdkapital. Dabei wäre es nicht nur aus Sicht von Gorgs nötig, „Schulen wieder auf einen erträglichen baulichen Stand zu bringen“.
… Schulen stecken aber noch in den Kinderschuhen
Diese Widrigkeiten führten zum Entschluss, sich regional breiter auszustellen. Gesucht und gefunden hat das VZN einen auf soziale Infrastruktur in Europa ausgerichteten Evergreen von Franklin Templeton. „Uns gefällt an diesem Vehikel, dass wir europaweit und über viel mehr Nutzungsbereiche als nur Pflegeheime und Kitas investieren können“, so Gorgs. Ein weiterer Grund für ein indirektes Investment ist, Headline-Risiken durch die Fondshülle abpuffern zu können.
Der Artikel-9-Fonds bewirtschaftet mittlerweile eine Milliarde Euro, die zu etwa drei Viertel in Healthcare-Immobilien, Bildungseinrichtungen sowie bezahlbares und soziales Wohnen und Studentenwohnheime investiert sind. Zu den weiteren Sektoren zählen „Justice & Emergency“, also beispielsweise Gerichtsgebäude oder Feuerwehrwachen, sowie „Civic“, worunter den Bürgern dienende Objekte verstanden werden und bei denen die Miete von der öffentlichen Hand kommt. Ein Beispiel aus dem Fonds ist ein Jobcenter in Dortmund. Insgesamt hält der Sicav-SIF in acht europäischen Ländern 39 soziale Infrastruktur-Immobilien. Regionaler Schwerpunkt ist die Eurozone. Beteiligt an dem Fonds wiederum sind 38 Investoren aus acht Staaten und aus verschiedenen Anlegergruppen.
Franklin Templeton will duale Rendite
Für die Anleger zielt Franklin Templeton auf eine „duale Rendite“ ab, wie Gaston Brandes erläutert: „Wir haben finanzielle und Impact-Ziele“, so der Managing Director bei Franklin Real Asset Advisors. „Finanziell wollen wir über einen rollierenden Fünf-Jahres-Zeitraum 500 Basispunkte über der Euro-Kerninflation beziehungsweise einen IRR von sechs bis acht Prozent erzielen. Aus nachhaltiger Sicht ist unser Ziel, sieben der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu unterstützen.“
Geld verdient der Fonds neben An- und Verkäufen – zu Letzterem kam es bislang noch nicht – über die Zahlungen der Pächter und Betreiber, mit denen langfristige Mietverträge abgeschlossen werden. „Ein großer Teil der Due Diligence nimmt die Analyse des Betreiberrisikos in Anspruch. Dabei achten wir nicht nur auf dessen finanzielle Substanz, sondern auch auf die Qualität von dessen Dienstleistung“, berichtet Brandes. Letzteres hilft, das Headline-Risiko zu reduzieren. Kein echtes Risiko sieht Brandes darin, dass soziale Infrastruktur anders als Assets der klassischen Infrastruktur – Flughäfen, Rechenzentren, Stromnetze – keinen echten Monopolcharakter haben. „Bei sozialer Infrastruktur reden wir in erster Linie von Bestandsimmobilien, deren Sanierung und Ertüchtigung über Jahre hinweg vernachlässigt wurde. Hierfür besteht ein sehr großer Kapitalbedarf.“

Das bislang größte Risiko kam jedoch vom Finanzmarkt: Wenig überraschend blieben gegenüber dem Zinsanstieg auch Gebäude mit Infrastruktur-Charakter nicht immun, was auf die Performance drückte. Brandes geht davon aus, dass der Immobilienmarkt nun die Talsohle erreicht hat. „Wir sehen realistischere Preisvorstellungen auf der Verkäuferseite und somit wieder etwas mehr Transaktionen. In den vergangenen drei Quartalen haben auch die Bewertungen wieder etwas angezogen.“ Marie Keil-Mouy, Franklin Templetons Head of Institutional Sales in Germany, bestätigt, dass eine Einpreisung der Zinsentwicklung nun erfolgt ist, was wiederum den Transaktionsmarkt belebt. „Der Ankauf neuer Objekte zu vernünftigen Preisen war schwierig. Jetzt konnte jedoch unser Team verschiedene, auch sehr große Objekte, akquirieren. Damit haben neue Investoren nun einen günstigen Einstiegszeitpunkt“, erklärt Keil-Mouy.
Stetige Nachfrage für soziale Infrastruktur
Nach der erheblichen Wertberichtung in den Immobilienmärkten, gerade in den gewerblichen Immobiliensektoren seit der zweiten Jahreshälfte 2022, sind Immobilienrenditen im Bereich sozialer Infrastruktur in den letzten Quartalen wieder gestiegen und befinden sich nun auf einem Niveau, das für Investoren interessant sein sollte, so Brandes. Dies wiederum spricht sehr für die Asset-Klasse Infrastruktur. „Unabhängig von der Lage an den Kapitalmärkten war und ist die Nachfrage nach Schulen, bezahlbarem Wohnraum oder anderer sozialer Infrastruktur immer gegeben. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem“, stellt Infrastrukturexperte Brandes heraus. Die Zahlungsbereitschaft der Nutzer beziehungsweise der Pächter goutiert ebenfalls Tobias Gorgs: „Im Gegensatz zu anderen Asset-Klassen wurde die Mietverpflichtung sehr hochgehalten. Damit war soziale Infrastruktur für uns über die Jahre ein Stabilisator im Portfolio.“
Überzeugen kann soziale Infrastruktur auch bezüglich Inflationsschutz. Gestiegene Handwerker- und Baukosten belasten die Ausschüttungshöhe kaum, da dieser Effekt durch die indexierten Mieten zu großen Teilen kompensiert wird. Das einzige Segment, in dem keine indexierten Mieten anfallen, sind die Studentenwohnheime, weil hier die Mietverträge in der Regel nur über sechs oder zwölf Monate abgeschlossen werden.
Artikel-9-Fonds verfolgt sieben SDGs
Die Impact-Ambitionen des Artikel-9-Fonds zielen mittlerweile auf die Sustainable Development Goals Nummer 3, 4, 6, 7, 8, 11 und 16 ab. Inwiefern diese Ziele erreicht werden, berichtet Franklin Templeton in einem jährlichen Impact Report. Dieser wird von der Firma Blue-Mark extern verifiziert. Brandes betont, dass die Nachhaltigkeitsziele „intentional“ sind und schon bei der Due Diligence seitens des hauseigenen Impact Teams aufgestellt werden. Der Fonds verfolgt ökologische Ziele wie die Reduzierung des Energieverbrauchs, peilt aber, wie der Fondsname impliziert, soziale Wirkungen an. Vier der sieben Goals des Fonds zielen auf eine soziale Wirkung ab. Als Beispiel-Investment nennt Brandes ein größeres Krankenhaus mit Altenwohnheim in Venedig, das vom Festland aus mit dem Wasser-Taxi nur in 45 Minuten zu erreichen war. Gemeinsam mit der Gemeinde Venetien sei es nun aber gelungen, für die Bevölkerung diese Fahrtzeit auf 20 Minuten zu reduzieren. Brandes betont an dieser Stelle, dass es noch keinen Impact generiere, ein Krankenhaus zu kaufen. „Bei Bestandsobjekten entsteht ein Impact erst dadurch, wenn wir durch Kapitalmaßnahmen dieses verbessern oder vergrößern. Bei einem anderen italienischen Krankenhaus entstand eine positive Wirkung auch dadurch, dass wir vor unserem Erwerb einen neuen Betreiber gefunden haben, was den operativen Betrieb des Krankenhauses sicherstellte.“
Gorgs betont, dass dieser nachhaltige Ansatz und die dahinterstehenden Ressourcen von Franklin Templeton für das VZN einen erheblichen Mehrwert darstellen. „Das Impact-Reporting hilft uns in der Kommunikation gegenüber unseren Mitgliedern und gegenüber unserer Aufsicht. Schließlich müssen wir für die Nutzung der Infrastrukturquote der Aufsicht einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.“ Nutzen zieht das VZN aber nicht nur aus dem Reporting, sondern auch aus dem Ansatz selbst. „Die soziale Wirkung mancher Assets gegenüber der jeweiligen Nachbarschaft können wir und unsere kleineren Partner nicht schaffen.“ Diese Vorteile, ergänzt Gorgs, würden auch das „nicht ganz optimal gelaufene Thema Ausschüttung“ für das VZN kompensieren.

Wie dem VZN bei Kitas und Schulen fällt es aber auch dem Franklin-Templeton-Fonds schwer, in die hiesige soziale Infrastruktur zu investieren. Aus Deutschland zählen neben dem erwähnten Jobcenter bislang nur zwei an eine technische Hochschule vermietete Objekte zum Portfolio. Die Bedenken der öffentlichen Hand vor privatem Kapital sind ausgeprägt. „Partnerschaftlich in die Zukunft unseres Landes zu investieren, hätte für alle Seiten einen positiven Effekt“, so Gorgs. Dem kann Marie Keil-Mouy nur zustimmen: „Die Interessen von langfristigen, institutionellen Investoren passen sehr gut zum langfristigen Investitionsbedarf auf kommunaler Seite.“ Ein Fortschritt ist immerhin regulatorisch zu verzeichnen. Die Leiterin des institutionellen Vertriebs in Deutschland verweist auf die neu eingeführte Infrastrukturquote in der Anlageverordnung, und die Erhöhung der Risikokapitalquote.
Deutsche Vorbehalte gegenüber privatem Kapital
Ein noch viel größerer Fortschritt wäre allerdings ein Mentalitätswandel auf staatlicher und kommunaler Ebene gegenüber Finanzinvestoren. Das Potenzial wäre auf jeden Fall groß. Und warum sollte nicht auch in Deutschland möglich sein, was in anderen Ländern funktioniert? Zumal Versorgungswerke, Sparkassen und Volksbanken sowie auch viele Versicherer und Pensionskassen regional verankert sind und der Staat sich auch nicht mehr zu null Prozent finanzieren kann. „Mir ist es ein Rätsel, warum hierzulande zwischen institutionellen Investoren aus Deutschland und möglichen anderen Finanzinvestoren kein Unterschied gemacht wird“, bedauert Gorgs und erwähnt dabei die soziale Verantwortung von Altersvorsorgeeinrichtungen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass beispielsweise Nordrhein-Westfalen bereit ist, privates Kapital zumindest für Antiterror-Übungshallen zu akzeptieren.
Interessiert ist das VZN aber auch daran, auf europäischer Ebene weiter in Infrastruktur zu investieren. „Dieser Fonds gibt uns gute Einblicke, welche Sektoren in welchen Ländern wie gut funktionieren. Ein Schritt könnte sein, künftig etwas spezifischer zu investieren“, gibt Gorgs einen Einblick in die Überlegungen der Altersvorsorgeeinrichtung. Möglicherweise hat auch Franklin Templeton wieder einen interessanten Ansatz für das Versorgungswerk. In der Planung ist ein geschlossener Value-add-Fonds für soziale Infrastruktur in Europa. Zu wünschen wäre, dass dieser mehr Assets in Deutschland findet.
Autoren: Patrick EiseleSchlagworte: Berufsständische Versorgungswerke | Gesundheits- und Pflegeimmobilien | Infrastruktur / Infrastructure Equity | Offenlegungsverordnung / SFDR | Soziale Infrastruktur
In Verbindung stehende Artikel:
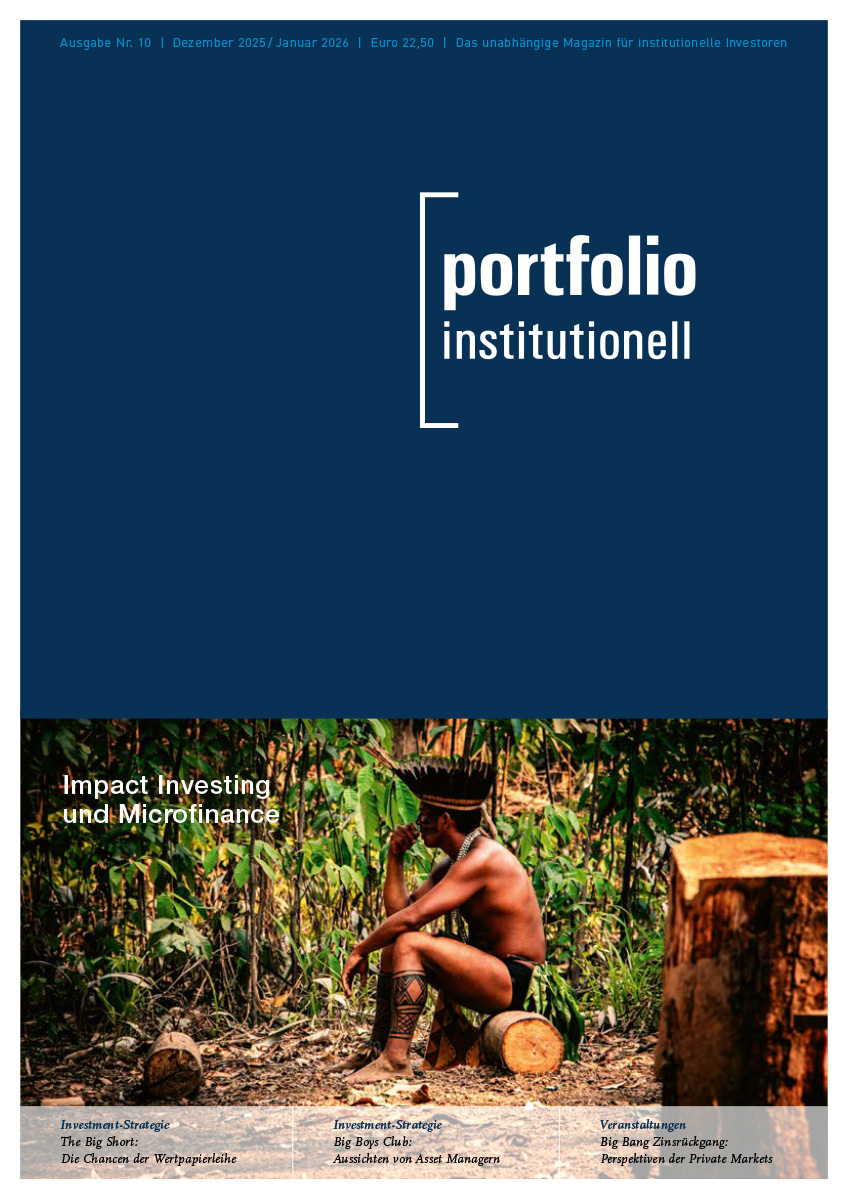
Schreiben Sie einen Kommentar