Batteriespeicher: Markt unter Hochspannung

Wie sich mit Stromspeichern Geldspeicher füllen lassen, diskutieren Angelica Becker, Reinhard Liebing, Rouzbeh Amini und Patrick Eisele. Nicht im Bild: Christoph Lüken, Daniel Egli und Tiziano Bottinelli. Fotograf: Alex Habermehl.
Nach Erzeugung und zuletzt Stromnetzen spielt die Musik bei Energieinfrastruktur nun immer lauter bei Batteriespeichern – dank des offensichtlichen Bedarfs und der gesunkenen Preise für Batterien. Die Umsetzung gestaltet sich aber alles andere als trivial.
Egal ob man das Fraunhofer-Institut oder die Bundesnetzagentur fragt, sich eine Ente ankuckt oder in der Bibel liest: Unterschiedlichste Quellen liefern Argumente für Batteriespeicher. So informieren die Fraunhofer-Forscher, dass bundesweit bis 2030 rund 100 und bis 2045 rund 180 Gigawattstunden elektrische Speicherkapazität nötig sei. Derzeit kommen Großspeicherbatterien auf drei Gigawattstunden.
Die Bundesnetzagentur informiert über Redispatch-Kosten von bis zu 2,7 Milliarden Euro in den vergangenen drei Jahren. Diese entstehen vor allem, wenn Stromerzeuger wegen der Netzstabilität ihre Einspeisung reduzieren müssen und dafür entschädigt werden. Ebenfalls zählt zu den Energiewende-Kuriositäten, dass dank dem großen PV-Zubau die Strompreiskurve die Gestalt einer Ente annimmt und man an dieser die Uhrzeit ablesen kann – und zwar von Jahr zu Jahr immer präziser. Morgens startet die Kurve am Bürzel und sinkt mit zunehmender Sonne Richtung Bauch ab. Hat die Kurve den tiefsten Punkt erreicht, ist es zwölf Uhr.
Tierisch geht es auch in der Bibel ab, wo Josef den Traum des Pharaos von sieben fetten Kühen und von sieben mageren Kühen so deutet, dass es in den Jahren des Überflusses an Nahrung der Bevorratung in Getreidespeichern für schlechte Zeiten bedarf. Etwas simpler lässt sich der Bedarf an Batteriespeichern auch damit erklären, dass bei der Energiewende bislang zu einseitig die Grünstrom-Erzeugung im Fokus stand und es naturgemäß manchmal Sonne und Wind gibt – und manchmal eben nicht.
Die Talanx gehört zu den Versicherern, die sich vor über zehn Jahren den Infrastrukturmarkt erschlossen haben und dabei, auch mit Hilfe des EEG, einen Schwerpunkt auf Energieinfrastruktur legten und hierbei wiederum auf die Erzeugung von Grünstrom. „Ein Blick in die Portfolios von Versicherungen oder anderen institutionellen Investoren zeigt oft einen Überhang an Erzeugungskapazitäten verglichen zu Netz- und Speicherinvestitionen. Durch Übernahme der Preis- und Abnahmerisiken lud das EEG dazu ein, viele Megawatt-Kapazitäten aufzubauen, ohne sich viele Gedanken über Strompreise, die Zeiträume der Strombereitstellung oder generell die Nachfrageseite machen zu müssen“, blickt Rouzbeh Amini, Head of Structuring & Origination, Infrastructure Investments bei der Talanx-Tochter Ampega, zurück. „Batterien geben uns nun die Chance, hier etwas korrigierend einzugreifen.“
Folge der einseitigen Ausrichtung auf die Grünstrom-Erzeugung sind negative Strompreise und Drosselungen der Erzeugungsanlagen, die die Wirtschaftlichkeit in Frage stellen. Diese Preisentwicklung trifft insbesondere auf PV-Anlagen vor allem um die Mittagszeit zu. Auf einer Veranstaltung von Recap informierte Tobias Federico vom Energie-Researcher Montel über Strompreisspannen auf Tagesbasis zwischen dem negativen Bereich „und bis zu 300 Euro pro Megawattstunde, wenn Renewables nicht zur Verfügung stehen und thermische Kraftwerke noch hochfahren“. Federico erwartet, dass der Zubau von Batterien diese Volatilität künftig etwas begrenzt, sie aber immer noch hoch bleiben wird.
Schutz vor Volatilität finden Energieproduzenten (noch) im EEG und in Power Purchase Agreements, PPAs, mit bonitätsstarken Abnehmern. „Für unseren großen PV-Park südlich von Leipzig, der mit einer Leistung von 650 Megawatt zu den größten Energieparks in Europa zählt, konnten wir damals noch ein sehr langfristiges PPA vereinbaren. Heute würde man vermutlich kein auskömmliches PPA mehr abschließen können, auf dessen Basis man einen Solarpark subventionsfrei bauen beziehungsweise finanzieren könnte – trotz stark gesunkener Gestehungskosten“, sagt Christoph Lüken, Geschäftsführer der Signal-Iduna-Tochter Sicore Real Assets. „In früheren Ertragskalkulationen haben wir schon 2016 ein, zwei Prozentpunkte wegen möglicher negativer Strompreise abgezogen. Dafür wurden wir damals belächelt, negative Strompreise werden aber künftig, gerade bei größeren Parks, noch eine viel höhere Relevanz erhalten. Je älter die Parks werden, desto mehr werden negative Strompreise auch Parks einholen, die bislang durch EEG-Tarife oder PPAs geschützt sind.“ Jetzt stelle sich für Anleger die Frage, wie es nach dem Auslaufen von EEG oder PPA mit einem Park weitergeht oder auch wie sich dieser heute schon optimieren lässt. Lükens Antwort: „Indem man ein attraktives Produktionsprofil zeigen kann! – und dafür können Batteriespeicher eine gute Lösung sein.“ Allerdings bestehen für Battery Energy Storage Systems, kurz Bess, Unwägbarkeiten. „Bess ist eine neue, sicherlich hochattraktive Asset-Klasse, birgt aber auch viele Herausforderungen und Risiken, die nicht genau in Zeit- und Geldeinheiten zu beziffern sind. Nicht zuletzt ist die Regulatorik im Fluss. Eine Unwägbarkeit liegt beispielsweise im Abschluss flexibler Netzanschlussvereinbarungen, die direkte Auswirkungen auf den Business Case des Projektes haben“, so Reinhard Liebing, Geschäftsführer des Dienstleisters Sustainable Investing Trust.
Die Erkenntnis der Sinnhaftigkeit von Energiespeichern ist auf dem hiesigen Finanzmarkt angekommen. Davon künden allein im September drei Beispiele. So vergibt der Asset Manager der britischen Versicherung Aviva Mezzanine-Gelder in Höhe von 150 Millionen Euro an die Berliner Terra One, einen Entwickler von Batteriespeichern. Zunächst ist die Entwicklung von 500 Megawatt an Bess Assets in Deutschland geplant, die bis 2028 operativ sein sollen. Verpartnert haben sich auch Palladio und Voltfang, ein weiterer Spezialist für Batteriespeicher. Im Rahmen der gemeinsamen Projekte wollen Palladio und Voltfang bis 2029 rund 250 Millionen Euro in die deutsche Batteriespeicherinfrastruktur investieren. Geldgeber für die Vorhaben sind vor allem Versicherer, Pensionsfonds und Versorgungswerke, die einen Transformationsfonds von Palladio allokiert haben. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Stromspeichern und der weiter sinkenden Technologiekosten ist jetzt ein besonders attraktiver Zeitpunkt, um in den Ausbau von Batteriespeichern zu investieren“, erklärte Palladio-Partner Oliver Sauer. Auch andere deutsche Adressen wie Luxcara, Ikav, Prime Capital und Solutio mischen auf dem Speichermarkt mit.
Bereits im Juni sorgte die Meldung für Aufmerksamkeit, dass Luxcara sich ein 520-MW-Bess-Projekt nahe Dortmund gesichert hat. Für das Großprojekt arbeitet der Asset Manager mit der Schweizer BKW und der Stadtwerke-Kooperation Trianel zusammen. Geplant ist für das Projekt ein Tolling Agreement. Beim Tolling geht der Eigentümer der Batterie quasi auf „Nummer sicher“, indem er eine fixe Miete vom Stromabnehmer, beispielsweise ein Stromhändler, bekommt. Beim Merchant-Modell dagegen handelt der Batterieeigentümer beziehungsweise dessen Dienstleister selbst mit Strom. Recap legt derzeit einen paneuropäischen, auch auf den First Mover Advantage abzielenden, reinen Batteriefonds auf. Für diesen will CEO Thomas Seibel nicht auf die Merchant-Upside verzichten. „Merchant bietet insbesondere für die nächsten Jahre so hohe Erlöse, dass Renditen von zwölf bis 14 Prozent gut erreichbar erscheinen. Im Tolling-Modell sind die Erlöse zwar scheinbar garantiert, allerdings nur halb so hoch wie im Merchant Case und man muss das Kreditrisiko des Batteriepächters in Kauf nehmen.“
Über diese Modelle und viele – auch kritische – Bess-Aspekte diskutierte auch eine Expertenrunde aus Vertretern der Talanx, Sicore (Signal Iduna), Ikav, Sustainable Investing Trust und EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich). Für Treuhänder ist Sicherheit ein hohes Gut, was auch für das Vergütungsmodell gilt. Andererseits sprechen für Merchant-Risiken zweistellige Renditen und Diversifikation. Aus Sicht von Amini können komplementäre Technologien und Ertragsmodelle im Portfoliokontext Stabilität erzeugen. „Wenn Erneuerbare Energien von der Strompreisvolatilität negativ betroffen sind, können Batterien einen Ausgleich schaffen – und dann kann man mit Merchant-Risiken als institutioneller Anleger besser leben. Auf Standalone-Basis, wenn man also nur die Batterie hat, macht Tolling für defensive Anleger mehr Sinn“, so Amini, der ergänzt, dass auf dem Commodity-Trading-Markt andere Player als Lebensversicherungen unterwegs sind. Wesentlicher Unterschied zum klassischen Rohstoffhandel ist, dass es bei der Profitabilität von Bess im Merchant-Modell nicht um die Richtung der Preisentwicklung, sondern um die Preisvolatilität geht.
Zum Preismodell laufen im Markt derzeit viele Debatten. Diese sollten jedoch nicht zu lange laufen, mahnt Daniel Egli, Leiter Origination Europe bei Ikav und verantwortlich für das deutsche Bess-Programm. Der Asset Manager setzt derzeit mehrere Batterieparks in Ostdeutschland mit einem Volumen von mehr als einem Gigawatt um. „Das Window of Opportunity dürfte die nächsten drei bis vier Jahre besonders weit offenstehen. In diesem Zeitraum ist es möglich, jährlich ein Viertel oder sogar ein Drittel der Capex-Kosten zu verdienen. Darum ist Time to Market derzeit wichtiger als die Frage des Vergütungsmodells“, so Egli. Den Break-even sieht Egli bei voller Kostenbetrachtung bei etwa sieben Jahren. Rein regulatorisch betrachtet schließt sich das Zeitfenster am 4. August 2029. Denn nur bis dahin gilt die 20-jährige Netzentgeltbefreiung für neue Bess-Projekte. Täglich Speicher zu laden und zu entladen, ist ökonomisch nur sinnvoll, wenn keine Netzentgelte anfallen.
Ob sich die Renditeerwartungen realisieren beziehungsweise das Zeitfenster genutzt werden kann, hängt vor allem von einer zügigen Genehmigung des Netzanschlusspunktes ab. „Wer jetzt einen Netzanschluss hat, hat ein sehr rentables Asset. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Window of Opportunity in vier bis fünf Jahren wieder schließt, da es dann zu viel Projekte gibt, weil alle wieder in die gleiche Richtung gerannt sind“, so Tiziano Bottinelli, Head Portfolio Development Europe der EWZ. Zustimmen kann man Bottinelli, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland aktuell Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher im Überfluss gibt. Auf Linkedin berichtet Eon-CEO Leo Birnbaum, dass allein seinem Unternehmen heute Anschlussanfragen für 330 Gigawatt Großspeicher vorliegen – eine nicht nur für Birnbaum absurde Zahl, da dies etwa der Last von 100 Millionen Haushalten entspreche. Birnbaum spricht von „Glücksrittern“ und Amini davon, dass „derzeit die Hürden für die Beantragung eines Netzanschlusses zu niedrig sind. Jeder kann an ganz vielen Standorten einfach mal sein Handtuch hinlegen.“ Noch ist eine Bess-Flut aber nicht erkennbar. Ein Grund ist, dass die Netzbetreiber durch die Vielzahl der Anträge – meist mit nur geringen Realisierungschancen – wegen des Windhundprinzips blockiert sind. Zudem ist die fehlende Bezugsleistung des Netzes ein technisches Hindernis. Ohne diese kann man eine Batterie aber nicht laden. Am fehlenden Bezug scheitert auch die Idee, den Netzanschluss von ready-to-build-PV-Parks, die heute ökonomisch keinen Sinn mehr machen, für einen Batteriepark zu nutzen. Angelica Becker, ebenfalls Ikav, nennt zwei weitere Engpassfaktoren: „Es besteht ein großer Mangel an Fachkräften und die Bestellzeiten von Transformatoren betragen je nach Spannungsbereich zwei bis drei Jahre. Ohne die Sicherheit, dass Projekte realisiert werden, baut man auch keine Personalbestände auf.“
Ein Hindernis stellen zudem die Ziele, Engpässe und Strategien der großen Übertragungsnetzbetreiber dar. „Diese haben den gesetzlichen Auftrag, im Bundesbedarfsplan festgeschriebene Maßnahmen des Netzentwicklungsplans umzusetzen, also derzeit besonders Übertragungsnetze auszubauen und den im Norden erzeugten Windstrom nach Süden zu den großen Verbrauchszentren zu bringen, nicht aber die aktuell beantragten Mengen an Batterien ans Netz anzuschließen“, erläutert Amini. Von Batterie-Begeisterung ist bei den Netzbetreibern wenig zu hören – auch nicht jenseits des Anschlussantrags-Tsunamis. Beispielsweise freut sich Amprion, dass die großen PV-Anlagen inzwischen deutlich besser auf Preise reagieren, also freiwillig abregeln, statt negative Preise für die Stromeinspeisung zu akzeptieren. „Daraus lässt sich ablesen, dass Preisanreize wirken – und wir müssen noch mehr Anlagen diesen Anreizen aussetzen“, so CEO Dr. Christoph Müller. Batteriebesitzern sollte bewusst sein, dass sie mit dem Betreiber eines Übertragungsnetzes einen Vertragspartner hätten, der im Zweifel für die Netzstabilität durch „Netz-Booster“ eigene Batteriekapazitäten vorhält und im Fall der Fälle nicht auf kommerzielle Batteriebetreiber, sondern Abschaltungen setzt und eventuell ungeregelte Stromeinspeisungen aus Batterien nicht immer zulässt. Diversifizieren lassen sich regulatorische Risiken per paneuropäischem Ansatz. „Die Netzbetreiber beispielsweise in Italien und Polen sind an Storage interessiert und zahlen feste Beträge für 15 Jahre für die Installation von Speichern, was dem Investor eine hohe Cashflow-Sicherheit gibt“, sagt Thomas Seibel, Recap.
Einig ist sich die Storage-Runde, dass in puncto Umsetzung die Rentabilität für „stand alone“ spricht. Zwar ist bei einem bestehenden PV-Park der Netzanschluss gegeben und wäre von seiner Leistung ausreichend, da diesen die Batterie nutzt, wenn die Sonne nicht scheint. Gegen eine solche Co-Location spricht aber die fehlende Bezugsleistung und auch die EEG-Förderung. Nimmt nämlich ein Speicher neben Grün- auch Graustrom auf, „ergraut“ der gespeicherte Grünstrom und verliert seine Förderung. Zumindest Stand heute spricht auch meist die Incentivierung des Parkbesitzers gegen eine Co-Location. „Der Parkeigentümer wird für nicht abgenommenen Strom entschädigt und diese Kosten werden sozialisiert. Also hat er keinen Anreiz, seinen Park mit einem Speicher zu optimieren“, erklärt Lüken. „Gesellschaftlich sinnvoller und günstiger wäre eine Incentivierung des Parkbesitzers, sich einen Speicher zuzulegen und auf Subventionen zu verzichten.“
Weitere Umsetzungsfrage: die Speichergröße. Der Trend ging vom Ein- zum Zwei-Stunden-Speicher. „Zwei-Stunden-Speicher zeigen aktuell die mit Abstand besten ökonomischen Ergebnisse. Perspektivisch geht der Markt aber davon aus, dass Vier-Stunden-Speicher kommen“, erklärt Egli. Um idealerweise nur zum niedrigsten Preis zu laden und zum höchsten zu entladen – und den IRR zu optimieren –, reichen Zwei-Stunden-Speicher. In Vier-Stunden-Speicher lässt sich dagegen mehr Kapital unterbringen. Seibel nennt noch weitere, künftige Argumente für größere Kapazitäten: „Ein Vier-Stunden-Speicher bietet noch mehr Arbitrage-Möglichkeiten und ist günstiger als zwei Zwei-Stunden-Speicher.“ Die aktuellen Investitionskosten für eine Batterie in Deutschland beziffert Seibel mit 600.000 Euro pro Megawatt. Den Break-even der Batterie sieht er bei fünf bis sechs Jahren und die Lebensdauer bei 15 Jahren.
Bedenklich kann Renewables-Investoren auch stimmen, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche in ihrem Realitätscheck der Energiewende aufs Gas drückt und entsprechende Kraftwerke im Volumen von mindestens 20 Gigawatt ausschreiben will. Diese dürften sich jedoch eher für länger anhaltende Dunkelflauten eignen. „Um im täglichen Gebrauch mit Batteriespeichern mithalten zu können, sind die Betriebskosten von Gaskraftwerken zu hoch. Für diese muss man Gas, Personal und CO₂-Zertifikate einkaufen“, urteilt Egli. Er stuft Gaskraftwerke jedoch als „Backbone“ der Energieinfrastruktur ein. Bis diese in Deutschland jedoch genehmigt und gebaut werden, könnten noch Jahre vergehen. Egli: „Dagegen erleben wir bei Batteriespeichern derzeit eine große Dynamik.“
Neben Strompreis, Technologien und Anschlusspunkten schlummert in Batteriespeichern auch eine philosophische Komponente: Handelt es sich denn noch um Infrastruktur oder eher um Private Equity oder eine Commodity-long-short-Hedgefonds-Strategie? Mit Blick auf die Hardware ist Bess für Seibel Infrastruktur, allerdings keine Core-Strategie: „Unter Berücksichtigung der Risiken bezüglich Technologien, Regulatorik und Markt handelt es sich aber um eine Value-add-Strategie.“ Das Risiko, dass Strompreisvolatilitäten sinken, sei jedoch durch den weiteren Zubau von Solar- und Windparks begrenzt. Auch für Christoph Lüken sind Batteriespeicher Teil des Infrastrukturuniversums. Er präzisiert: „Die eigentlichen Assets sind der Netzanschluss und der Bezug. Die sind so wichtig wie bei einer Immobilie die Qualität des Grundstücks und haben eine Art Evergreen-Charakter, der von der Leistungsfähigkeit der aktuell genutzten Batterie unabhängig ist.“ Pro Infrastruktur argumentiert auch Reinhard Liebing. Dieses gilt für die Variante, dass man den Abnahmevertrag nicht mit einem Netzbetreiber, sondern mit einem Großabnehmer abschließt: „Battery as a Service kann für Unternehmen Sinn machen, die Speicher nicht auf die Bilanz nehmen, aber die Vorteile wie niedrigere Energiekosten durch Eigenverbrauch und Lastspitzenmanagement, höhere Versorgungssicherheit bei Stromausfällen und eine verbesserte Energiebilanz nutzen wollen. Dann hat das Unternehmen die Vorteile und der Batterieinvestor beispielsweise einen bonitätsstarken Vertragspartner. Wenn der Bess-Investor über viele Jahre einen solchen bonitätsstarken Mieter der Anlage hat, der vertraglich fest vereinbarte ‚Mietzahlungen‘ beispielsweise über zehn Jahre leistet, spricht viel für Infrastruktur“, führt Liebing aus. Schlussendlich hängt die Asset-Klassen-Zuordnung von der Intention des Investors ab. „Zielt man auf einen kurzfristigen Verkauf ab, ist es mehr Private Equity, stehen die Erlösströme im Vordergrund handelt es sich eher um Infrastruktur. Dann stellt sich noch die Frage, ob es mehr Core+ oder mehr Value-add ist“, so Ikavs Angelica Becker.
Gerade mit zunehmender Reife dürfte Bess neben Erzeugung und Netzen prominenter Teil der Energieinfrastruktur werden – aber mit welcher Quote? Eine erste Indikation wagt Lüken: „Ich könnte mir vorstellen, dass Bess innerhalb des Energieinfrastrukturportfolios auf einen Anteil von zehn bis 20 Prozent kommt.“
Autoren: Patrick EiseleSchlagworte: Energiewende | Erneuerbare Energien / Renewables | Großspeicherbatterien / Battery Energy Storage Systems | Print-Ausgabe | Wind- und Photovoltaikparks
In Verbindung stehende Artikel:
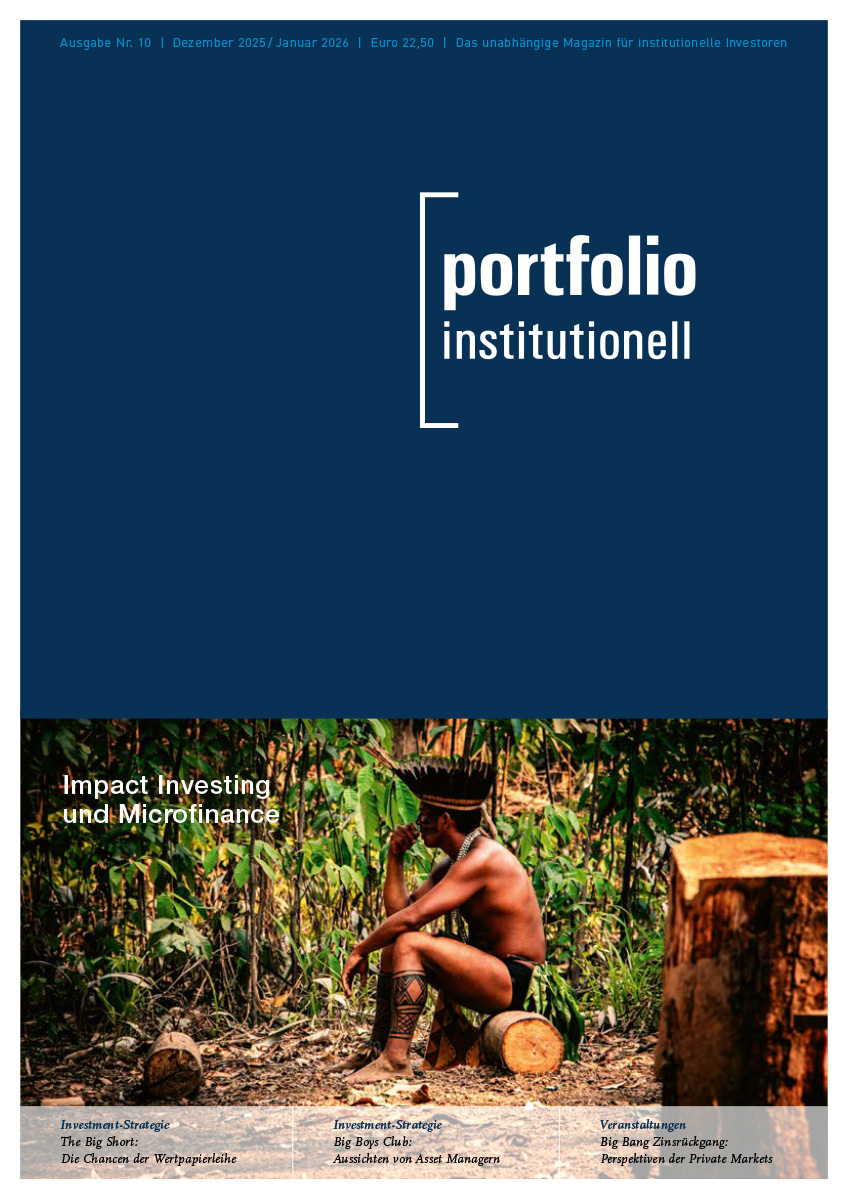
Schreiben Sie einen Kommentar