Der Weg ist das Ziel

In einem Roundtable-Gespräch, organisiert und durchgeführt von portfolio institutionell, beschritt Redakteur Tobias Bürger mit Danny Tuchlinsky (ÄVLB), Kathrin Schmidt (GVV) und Kai Wottawah (Franklin Templeton) den Entwicklungspfad bei Private Market Assets der beteiligten Großanleger (v. l. n. r.). Fotograf: Alex Habermehl.
Alternative Anlagen sind in den Portfolios institutioneller Investoren fest etabliert. Aber natürlich setzen die Großanleger unterschiedliche Akzente, wie der Alternatives-Roundtable von portfolio institutionell zeigt. Im Gespräch geben ein berufsständisches Versorgungswerk, eine Solvency-II-regulierte Kommunalversicherung und ein global operierender Anbieter Einblick in ihr Know-how. Die Fachleute sprechen über ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, und die Ambitionen, die sie hegen. Das gemeinsame Motto könnte lauten: Der Weg ist das Ziel.
In den vergangenen zwei Dekaden gab es wohl kaum ein Thema, das die institutionelle Kapitalanlage in Deutschland inhaltlich so sehr geprägt hat, wie die zunehmende Verbreitung der Privatmarktanlagen und deren wachsende Vielfalt. Getrieben von der Aussicht auf unkorrelierte Renditen, stabile Ausschüttungen sowie robuste Portfolios und befeuert vom Rückzug der Banken aus Teilen des Kreditgeschäfts haben nicht-börsliche Beteiligungen rasant an Bedeutung gewonnen. Institutionelle Anleger finanzieren heute völlig selbstverständlich Erneuerbare-Energien-Projekte, halten Beteiligungen an Infrastruktur-Assets und versorgen Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen mit Darlehen.
Während die Vielfalt alternativer Investments keine Grenzen zu kennen scheint, ist es an der Zeit, innezuhalten und die Entwicklung Revue passieren zu lassen. In einem Roundtable-Gespräch, organisiert und im September 2025 durchgeführt von portfolio institutionell, sprachen Portfoliomanagerin Kathrin Schmidt von der GVV-Kommunalversicherungsgruppe, Danny Tuchlinsky, Referent Kapitalanlagen und Investmentmanager bei der Ärzteversorgung Land Brandenburg (ÄVLB), sowie Kai Wottawah (Institutional Sales Director für Deutschland bei Franklin Templeton) über ihre Sichtweisen auf das Private-Markets-Spektrum.
Herangehensweise beim Bestandsaufbau
Die derzeit bedeutendste Anlageklasse im Bereich der Privatmärkte ist Private Equity – für viele gehört sie zu einem breit gestreuten Portfolio ganz selbstverständlich dazu. Die Zugangswege, die man hierfür beschreiten kann, sind vielfältig. Bekanntlich können Investitionen vom Anleger selbst in die einzelnen Fonds der Anbieter (GPs) vorgenommen werden. Oder es wird ein am Markt tätiger Berater oder Dachfonds-Manager beauftragt, die entsprechende Auswahl vorzunehmen.
Franklin Templeton, eine globale Investmentgesellschaft mit auf Privatmärkte spezialisierten Tochterunternehmen, hat sich in den vergangenen zehn Jahren eine internationale Investmentplattform aufgebaut – wie Kai Wottawah im Gespräch sagte. Es habe Zukäufe und Investitionen in neue Teams gegeben. „Wir sind mittlerweile ein Top-10-Anbieter in dem Bereich. Bei uns sind Immobilien, Private Equity, Private Credit, Liquid Alternatives und seit Neuestem auch Digital Assets verfügbar.“ Der im kalifornischen San Mateo (Silicon Valley) beheimatete Investmentanbieter verwaltet Vermögen von über 1,6 Billionen US-Dollar.
Wenn Kai Wottawah mit Marktteilnehmern über die Ausgestaltung einer individuellen Private-Markets-Allokation spricht, steht für ihn zunächst einmal die Frage nach dem Wertbeitrag der jeweiligen Anlageklassen für das Gesamtportfolio im Raum. „Und zwar noch bevor wir in die Anforderungen einsteigen, die sich aus der Regulatorik heraus für den jeweiligen Anleger ergeben. Sofern es einen Wertbeitrag gibt – und damit meine ich nicht nur das Rendite-Risiko-Verhältnis, sondern auch Faktoren wie Cashflows, Liquiditätsprofile sowie das Verhalten in schwierigeren Marktphasen –, gehen wir auf die nächste Stufe und erörtern, welche Zugangswege in Betracht kommen“, sagt der Fachmann, der in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem in der Direktanlage einer Versicherung aus dem Sparkassenlager tätig gewesen ist.

von Redakteur Tobias Bürger (links). Fotograf: Alex Habermehl.
Gespräche über den passgenauen Zugang zum Private-Markets-Universum hat Kathrin Schmidt schon einige geführt. Sie ist seit fünf Jahren als Portfoliomanagerin für die traditionsreiche GVV-Kommunalversicherungsgruppe tätig, deren Geschäftsgebiet sich vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz (ohne Landesteil Pfalz), Hessen, dem Saarland, Berlin, Bremen, Hamburg sowie dem Landesteil Hohenzollern-Sigmaringen von Baden-Württemberg befindet. Ein Teil ihrer Aufgaben ist es, eine diversifizierte Private-Equity-Allokation aufzubauen.
Außerdem investiert die Diplom-Betriebswirtin (BA) laufend den Rentendirektbestand der Versicherung angepasst an das Marktumfeld. Gemeinsam mit zwei Kollegen steuert sie die Assets des Versicherers, der Städte, Gemeinden, Kreise, kommunale Unternehmen ebenso wie kommunale Sparkassen und Privatpersonen mit Versicherungsschutz versorgt.
Das Anlagevolumen der GVV beträgt 1,7 Milliarden Euro. Schwerpunkt sind festverzinsliche Wertpapiere. Die Anleihenquote übertrifft mit 74 Prozent alle anderen Asset-Klassen im Portfolio der Kölner, sie umfasst neben dem Rentendirektbestand auch Private Debt. Mit dieser Quote ist die GVV keineswegs ein Ausreißer nach oben. Vielmehr liegt sie damit noch unter dem Durchschnitt der deutschen Versicherungswirtschaft (75,8 Prozent). „Wir fühlen uns mit diesem Bestand sehr wohl“, sagt Kathrin Schmidt, „weil wir damit einerseits laufende Erträge durch unsere liquiden Anleihen generieren, was für uns als Versicherer sehr wichtig ist. Und andererseits können wir einen gewissen Teil an illiquiden Investments halten.“ Die Portfoliomanagerin merkt an, dass das variabel verzinste Private Debt für die GVV derzeit die wichtigste unter den alternativen Anlageklassen ist.
Auch Danny Tuchlinsky hält große Stücke auf Private Debt. Der Investmentmanager der Ärzteversorgung Land Brandenburg begründet das unter anderem mit der Rendite. Denn „im Portfoliokontext ist die Ausgestaltung durch variable Zinsen sehr attraktiv“, wie er sagt. Der Regulierungsrahmen des steuerbefreiten berufsständischen Versorgungswerkes mit Sitz in Cottbus ist mit der Anlageverordnung jedoch ein ganz anderer als der der steuerpflichtigen GVV, die das Dreisäulenregelwerk Solvency II anwendet. Welchen Einfluss das auf die jeweilige Risikobereitschaft und auf die Asset-Allokation der Anwender hat, dazu kommen wir später.

Nach Einschätzung von Kathrin Schmidt ist Private Debt für Solvency-II-Anleger vorteilhafter als Private Equity. Zur Begründung verweist die Portfoliomanagerin auf den Zusammenhang der dabei erzielbaren Rendite und dem Risiko, das die Modellierung unter Solvency II vorgibt.
„Aufgrund der variablen Verzinsung besteht kein großes Zinsrisiko, sondern nur das reine Spread-Risiko. Ein solches Investment ist aufgrund der gestiegenen Leitzinsen plus Spread, sofern es in Euro denominiert ist und kein Fremdwährungsrisikoanteil hinzukommt, höchst interessant“, erklärt sie. „Gleichwohl diversifizieren wir zunehmend auch in andere Privatmarktanlagen wie Private Equity.“
Solvency II beeinflusst die Quote des Rentendirektbestands der GVV, die ihre Bilanzen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) aufstellt, maßgeblich. Kathrin Schmidt ordnet den gewählten Anlageschwerpunkt so ein: „Wir haben eine sehr hohe Bedeckungsquote, das ist uns als Versicherer natürlich sehr wichtig.“ Die Bedeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang ein Versicherer die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen erfüllt. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den Eigenmitteln und den Solvenzkapitalanforderungen (SCR) der von ihr eingegangenen Risiken. Danach gefragt, ob Solvency II in der Kapitalanlage vor diesem Hintergrund eher hilfreich oder eher hinderlich ist wie ein Bremsklotz, antwortet die Portfoliomanagerin diplomatisch: „Wo uns Solvency II auf jeden Fall hilft, ist bei der Ermittlung der Risikoparameter.
Wir sind eine eher kleine Versicherung und verwenden aus Kapazitätsgründen das Standardmodell der Aufsicht. Ich nehme die darin genannten Risikomaße dankbar entgegen.“
Grünes Licht für Private Equity
Ebenso wie alle anderen Großanleger steht auch Kathrin Schmidt immer wieder vor der Aufgabe, die passenden Anlageklassen zu selektieren, die für ihre Organisation geeignet sind. Dabei muss sie abwägen zwischen den Renditeerwartungen der Assets, der gedämpften Volatilität von Privatmarktanlagen und ihrem Beitrag zur Diversifikation gegenüber den vorhandenen Assets. Als Schmidt im Jahr 2020 zur GVV kam, hatte man dort bereits Immobilien, Private Debt und Infrastruktur allokiert. 2022 stiegen die Kölner über einen Dachfondsmanager zuerst in Secondary schließlich auch in Primary Private Equity ein. Stand heute liegt die Zielquote illiquider Investments bei 20 Prozent, wovon zwei Prozent auf Private Equity entfallen.
Aus Gründen der Streuung haben sie bei der GVV auch Primary-Midmarkets-Dachfonds gezeichnet. „Unser Fokus liegt auf dem Mid-Market-Segment, weil wir hier glaubhaft erkennen, dass Private Equity einen Mehrwert bieten kann, Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen. Wir selbst sind ja auch ein mittelständisches Unternehmen“, sagt Portfoliomanagerin Schmidt bei ihrem Heimspiel in Köln. Weil die Abrufe der Fondsmanager bei Secondaries etwas schneller erfolgen als bei Primary-Fonds – dort dauert es regelmäßig drei Jahre bis die Verantwortlichen passende Investments finden – und man als Anleger so schneller ein Portfolio aufbauen kann, ist die Versicherung heute dort mit einem leichten Übergewicht gegenüber den Primaries unterwegs. Langfristig soll der Anteil an Primary-Fonds noch zunehmen, der Anteil an Secondary-Fonds soll dennoch eine wesentliche Rolle spielen.

Der Markt für Secondaries ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, wie Kai Wottawah anmerkt. Zugleich räumt er mit einem Vorurteil auf, was diesen Zweitmarkt angeht: „Es müssen nicht immer Notverkäufe sein, die das Angebot prägen, sondern auch strategische Anpassungen aufseiten der Investoren.“ Denkbar sei etwa die Entscheidung eines Leiters Kapitalanlage oder seines Vorstands, der eine Asset-Klasse aussortieren möchte, um das Portfolio umzubauen. „Solche Situationen gibt es. Es sollte nicht immer notgetrieben sein. Andernfalls wäre es ja wirklich nur ein opportunistischer Markt. Und das ist es ja gerade nicht.“
Die Anlageverordnung mit ihren gesetzlich zulässigen Vermögensgegenständen für das Sicherungsvermögen bildet für Danny Tuchlinsky von der Ärzteversorgung Land Brandenburg mit Kapitalanlagen im Marktwert von rund 3,4 Milliarden Euro den Rahmen seines Tagesgeschäfts. Das berufsständische Versorgungswerk wurde 1992 gegründet und verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, das jeweils um die 20 Prozent Beteiligungen und Aktien sowie jeweils 30 Prozent Immobilien und Renten umfasst. Aus dem Portfolio lässt sich auch eine Infrastrukturquote ableiten, die rund zehn Prozent beträgt und hauptsächlich aus Equity-Investments besteht.
Interessanterweise hat das Ärzteversorgungswerk zusätzlich zur Anlageverordnung interne Leitlinien niedergeschrieben. Dabei geht es zum Beispiel um die Taktik bei Anlageentscheidungen und darum, immer eine hohe Diversifizierung auf allen nur denkbaren Ebenen zu fahren. „Das betrifft neben der regionalen Betrachtung auch die Streuung innerhalb der Vehikel, die man zeichnet“, erklärt Danny Tuchlinsky, und bezieht auch die Manager mit ein. „Streuung ist das A und O.“ Und ebenso wie Kathrin Schmidt von der GVV hat auch die ÄVLB zuletzt den Rentenbestand wieder hochgefahren. „Aber immer unter der Maßgabe, dass der Rechnungszins von 3,25 Prozent als Kupon beziehungsweise als Rendite draufsteht“, wie der Investmentmanager zu bedenken gibt. Den Rentenbestand stuft Tuchlinsky als relativ sicheren Ergebnisbringer ein.
Auf die hypothetische Frage, ob die arbeitsaufwändigeren und noch dazu illiquideren alternativen Anlagen infolge der Zinswende nun wieder an Bedeutung verlieren, entgegnet der Fachmann unmissverständlich: „Bloß nicht! Die Diversifikation, die sie uns ermöglichen, ist außerordentlich wichtig. In der Vergangenheit gab es immer wieder Phasen, in denen einzelne Anlageklassen nicht geliefert haben. Warum sollte das in Zukunft anders sein? Da ist man froh, wenn man auf die Erträge aus anderen Investments zurückgreifen kann. Und da gehören die Alternatives ganz klar dazu. Mag ihr Anteil am Portfolio auch gering sein, so können sie doch einen signifikanten Anteil am Ergebnis haben.“
Ähnlich argumentiert Kathrin Schmidt und ordnet ihre Arbeit in den Kontext von Solvency II ein: „Als Versicherung sind wir von Solvency II getrieben. Vor diesem Hintergrund investieren wir bevorzugt im europäischen Markt, denn wir müssten Fremdwährungsrisiken durch zusätzliches Eigenkapital unterlegen. Aber nichtsdestotrotz muss die Diversifikation immer Vorrang haben. Deswegen allokieren wir zum Beispiel Private Equity anteilig auch in den USA. Wir sind schließlich ein Kapitalanleger und haben Renditeziele.“

Die Ärzteversorgung Land Brandenburg investiert weltweit. Wobei das nicht für alle Anlageklassen gilt. Denn bei Immobilien konzentrieren sich die Cottbuser auf Europa und Nordamerika. Zur Abrundung gehört auch eine Portion Asien dazu. „Aber ansonsten wollen wir weltweit anlegen mit der Maßgabe, dass es sich um Länder handelt, die juristisch stabil sind und bei denen man eine möglichst hohe Sicherheit hat, dass man das investierte Kapital auch wieder zurückerhält.“ Die USA seien als größter Markt natürlich „gesetzt“, das gilt auch für Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Kanada und Europa. Interesse signalisiert Danny Tuchlinsky auch an den Emerging Markets und zwar an jenen Ländern in diesem Sammelbecken, „die gerade bei den Alternatives zunehmend von Bedeutung sein werden“, wie er betont. „Gleichwohl muss man als Investor immer auch im Blick behalten, wie sicher das Geld dort allokiert ist.
Das juristische Rahmenwerk, das man in den einzelnen Ländern vorfindet, ist hierbei ausschlaggebend.“ Die ÄVLB ist nach Einschätzung von Danny Tuchlinsky, der seit 2018 dort operiert, ein eher konservatives Versorgungswerk. Wie der frühere Investment Consultant in der Gesprächsrunde erklärt, gingen die Anleger der Brandenburgischen Ärzte schon 2011 dazu über, dem Portfolio alternative Anlagen beizumischen. Der Einstieg erfolgte anfangs bei Private Equity, Infrastruktur, Agriculture sowie Private Debt. Das sei damals eine mutige Entscheidung gewesen, die Risikokapitalquote neben den liquiden Aktien zu erweitern und auch illiquide Investments zu zeichnen, wie der Fachmann einschätzt.
„Vor dem Mut und der Weitsicht der Entscheidungsträger muss man den Hut ziehen.“ Zur Begründung erinnert Danny Tuchlinsky an die damaligen Umstände: „Das war die Zeit der Euro-Finanzkrise, kurz davor herrschte die Weltfinanzkrise. Sich in einer solchen Phase in neue Bereiche hineinzubewegen, das erforderte Rückgrat.“ Doch der Einstieg dürfte den Brandenburgern nicht allzu schwergefallen sein. Schließlich sanken die Renditen auf Festverzinsliche schon damals zunehmend unter den Rechnungszins. Und gegen eine breite Streuung der Renditequellen war nichts einzuwenden.
Das Portfolio hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Agriculture ist darin nicht mehr enthalten. Vor drei Jahren kam hingegen ein eigener Baustein „nachhaltige Infrastruktur“ hinzu. Ausgangspunkt dafür war eine separate Quote, die zuvor in Nordrhein-Westfalen konzipiert und umgesetzt wurde. Sie schafft zusätzlichen Spielraum, da Anlagen, die als „nachhaltige Infrastruktur“ eingestuft werden, nicht länger unter die chronisch ausgelastete Risikokapitalquote fallen, sondern separiert abgebildet werden. Damit lässt sich also Platz schaffen für zusätzliche Ertragsbringer. „Wir sind dem Vorbild aus NRW gefolgt und aktiv auf unsere Aufsicht zugegangen. Dort haben wir erfolgreich dafür geworben, eine solche Quote auch bei uns umzusetzen und erhielten von dort sehr konstruktive Unterstützung“, erinnert sich Danny Tuchlinsky.
Kai Wottawah beobachtet den Wandel institutioneller Portfolios mit großem Interesse. Im Hinblick auf das Spektrum alternativer Investments betont er, dass die Investoren derzeit sehr heterogene Zielsetzungen verfolgen: Es gibt solche, die ihre Zielquoten in Private Markets bereits weitgehend erreicht haben und darauf Anpassungen vornehmen, und solche, die sich noch in der Aufbauphase befinden. „In beiden Fällen stellt sich die Frage, wie neue Private-Markets-Anlagen sinnvoll und strategisch integriert werden können“, erklärt Wottawah. „Frische Mittel müssen investiert werden oder eine gezielte Umallokation bestehender Bestände findet statt – häufig mit dem Ziel, Portfolios breiter aufzustellen und resilienter gegenüber Marktzyklen zu machen.“ Ein gutes Beispiel sei die GVV, die ihr Private-Equity-Portfolio konsequent weiterentwickle, um langfristig stabile Renditen mit attraktiven Diversifikationseffekten zu verbinden.

Daran anknüpfend spannte Danny Tuchlinsky den Bogen zu aktuellen Entwicklungen in Asien. Dort vollzieht sich im Infrastrukturmarkt die Entwicklung, wie es sie in Europa bereits vor ungefähr zehn Jahren gegeben hat. Dabei geht es um das Aufkommen neuer Akteure. „Neben den marktbeherrschenden Generalisten, mit denen institutionelle Anleger in asiatische Infrastruktur investieren, betreten vermehrt Asset Manager den Markt, die aufgrund ihrer Größe agiler handeln und verstärkt Plattformökonomien nutzen“, sagt der ÄVLB-Referent, der diese Investments als eine Mischung aus Infrastruktur und Private Equity einordnet. „Wir konzentrieren uns nicht nur auf Core-Infrastruktur, sondern auch die Infrastrukturökonomie daneben“, gibt er zu bedenken.
Themen wie Erneuerbare Energie und Digitalisierung spielen eine große Rolle. In diesem Markt gebe es viele Chancen und Opportunitäten. Den Blick noch einmal auf das ÄVLB-Portfolio gerichtet, macht der Fachmann deutlich, was an dieser Entwicklung so interessant ist: „Das Portfolio sieht gerade im Infrastrukturbereich vor, dass die großen Manager auf jeden Fall abgedeckt werden. Denn gerade bei der Core-/Core-Plus-Infrastruktur kommt es auf die Vernetzung in die politischen Ebenen in den Ländern und Regionen an. Bei den kleinen Managern ist das eine opportunistische Beimischung. Man könnte sagen, das ist ein Core-Satellite-Ansatz!“
Wenn es um die Abwägung zwischen erfahrenen Generalisten und Neueinsteigern in den Asset-Management-Markt geht, machte Tuchlinsky deutlich, dass Investoren die Erfahrung und die Größe der Anbieter überaus zu schätzen wissen – gerade im Infrastrukturbereich –, „denn sie kann signifikant den Unterschied machen. Die großen Player ermöglichen große Investitionssummen. Das kann ein entscheidendes Auswahlkriterium sein. Kleinere Häuser nehmen wir aber gerne dazu, auch aufgrund ihrer Flexibilität und Schnelligkeit.“ Hier gehe es auch darum, in neue Märkte einzusteigen und gemeinsam Erfahrungen zu sammeln – und wenn es gut läuft, eine höhere Rendite einzustreichen.
Wenn man Kathrin Schmidt danach fragt, ob ihr in Sachen Infrastruktur der Sinn eher nach Equity oder Debt steht, erfährt man, dass sie zu Equity neigt. Zur Begründung spannt sie den Bogen zur Private-Debt-Allokation: „Wir vergleichen an dieser Stelle tatsächlich Infrastructure Debt mit Private Debt. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Rendite in Relation zum Risiko in Private Debt attraktiver ist.“
Demnach bevorzugt die GVV auf der Zinsseite Private Debt und auf der EK-Seite Infrastruktur. Und wo genau? „Wir sind überwiegend in bereits bestehenden Projekten mit abgesicherten Cashflows investiert, zum Beispiel im Transport oder in Leitungen. Die über viele Jahre hinweg gesicherten Cashflows, die wir dort vorfinden, lassen uns ruhig schlafen.“ Dass mit dem Aufkommen Erneuerbarer Energien zunehmend auch Greenfield-Risiken verbunden sind, macht Schmidt keineswegs nervös. „Das ist für uns eine Beimischung. Unser Portfolio mit den Fonds ist breit diversifiziert.“
Danach gefragt, wie sich die Bedeutung von Infrastruktur in den Portfolios institutioneller Investoren generell entwickelt hat, antwortete Danny Tuchlinsky in einem Beitrag für den Bundesverband Alternative Investments kürzlich so: „Zu Beginn der Niedrigzinsphase folgten Investoren klassischer Core Infrastructure, mit Fokus auf Infrastrukturprojekte wie Brücken, Häfen, Straßen und Flughäfen.“ Inzwischen sei der Trend zu Core-Plus-Investitionen und Plattformökonomien stark ausgeprägt.
Beim Roundtable in Köln machte er daran anknüpfend deutlich, dass es für langfristige Investoren entscheidend sei, eine Infrastruktur-Allokation über die Jahre hinweg aufzubauen, und zwar unabhängig von kurzfristigen makroökonomischen Entwicklungen. Für ihn als Quoteninvestor sei Eigenkapital deutlich attraktiver als Infrastructure Debt, einerseits aus Renditegründen in der Risikokapitalquote, andererseits aber auch aufgrund der Frage nach Verwertungsmöglichkeiten im illiquiden Bereich und ob EK- und FK-Geber hier doch ein identisches Risikoprofil einkaufen. „Wenn ja, vereinnahmen wir lieber die EK-Prämie.“
In den Aufbau eines Private-Equity-Portfolios im aktuellen Marktumfeld hat auch Kathrin Schmidt viel Zeit investiert. Und ein relevantes Thema, das daran anknüpft, betrifft die Liquiditätsplanung. „Wenn man jedes Jahr gleich viel zeichnet, ist man darauf angewiesen, dass die Gelder aus früheren Investments planmäßig zurückkommen“, so die Portfoliomanagerin. „Und ich denke, man hat 2024 und auch in diesem Jahr gesehen, dass die Gelder einfach nicht so schnell fließen, wie man sich das wünscht.“
In der Cashflow-Planung kann das zum Problem werden, vor allem dann, wenn man sich zur Zeichnung von Fonds verpflichtet hat und das Geld abgerufen wird. Doch wie geht man vor diesem Hintergrund an die Liquiditätssteuerung heran? Und wieviel Geld sollte man als Puffer zurücklegen? Oder wartet man ab, bis die Gelder zurückkommen und zeichnet erst dann? Kathrin Schmidt hat sich dafür entschieden, neue Zusagen erst dann abzugeben, wenn ein Großteil der erwarteten Rückflüsse früherer Investments auf dem Konto verbucht worden sind. Dadurch schwankt zwar die Quote der Alternativen, aber das gehört zur Strategie. Die Private-Equity-Quote der GVV befindet sich noch im Aufbau, doch auch dort wird diese Regel dann gelten.
Auch Danny Tuchlinsky schenkt der PE-Quote mehr Beachtung. „Wir haben in letzter Zeit viele Commitments gezeichnet, gerade im Private-Equity-Bereich“, wie er in Köln verlautbarte. Zugleich räumte er ein, dass Timing nicht möglich ist. „Wenn ich jetzt zeichne, habe ich eine Investitionsperiode von mehreren Jahren. Auf die Hoffnung, in der Exit-Phase in beispielsweise zehn Jahren ein besseres Marktumfeld vorzufinden, sollte man sich nicht einlassen. Das stetige Investieren über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg ist entscheidend. Diese langfristige Stetigkeit kann aber bei einigen Investoren in der Umsetzung schwierig sein.“
Festzuhalten bleibt, dass institutionelle Investoren ihre Portfolios um eine Fülle alternativer Anlagen bereichert haben und dies auch weiterhin tun. Dabei setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte. Aber alle haben ein gemeinsames Ziel. Dieses besteht darin, die Struktur ihrer Assets unter den sich bietenden Möglichkeiten noch besser zu machen. Das ist nichts, was sich von heute auf morgen erreichen lässt. Man könnte also erneut sagen: Der Weg ist das Ziel!
Autoren: Tobias BürgerSchlagworte: Alternative Anlagen | Infrastructure Debt | Infrastruktur / Infrastructure Equity | Privat | Private Credit / Private Debt / Nichtbankenkredite | Private Equity | Privatmarktanlagen / Private Assets
In Verbindung stehende Artikel:
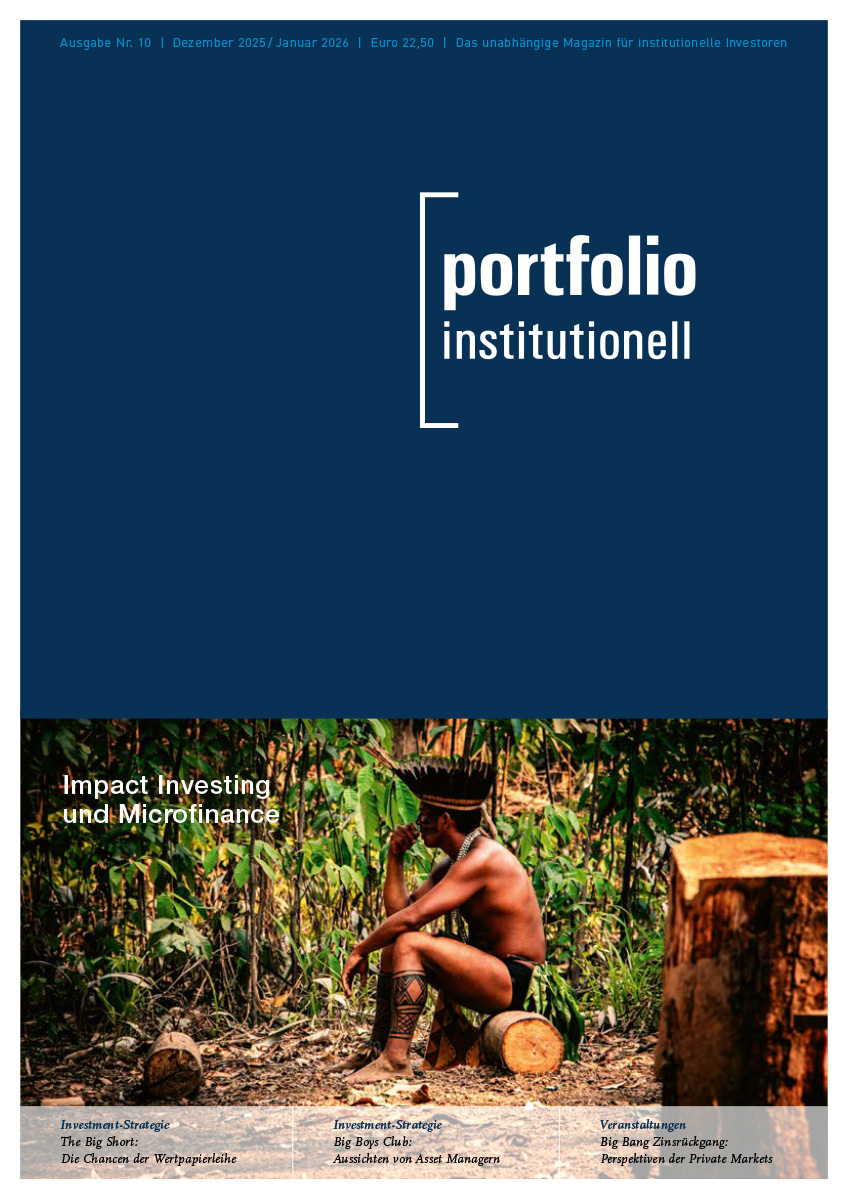
Schreiben Sie einen Kommentar